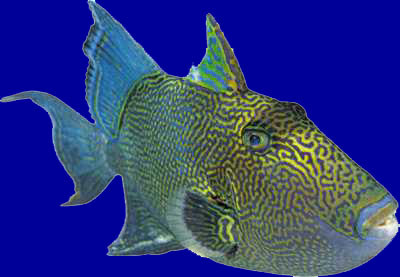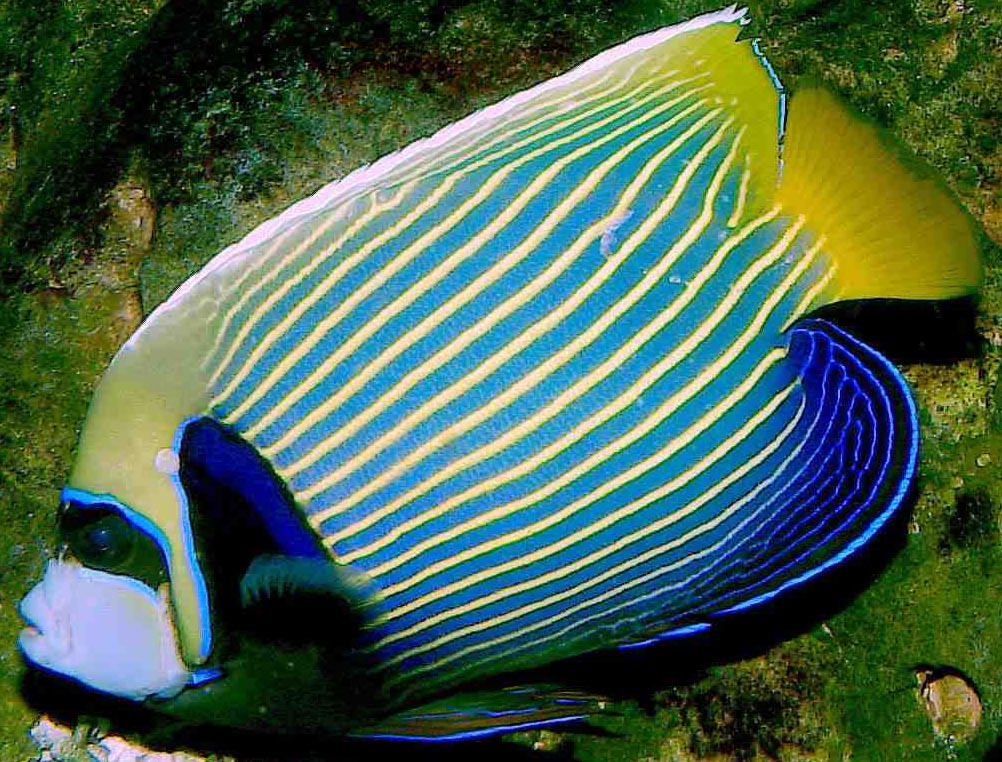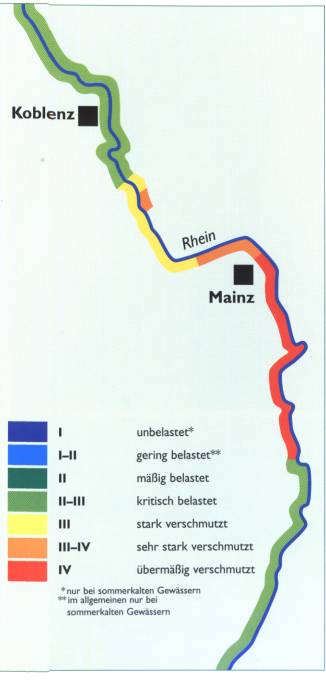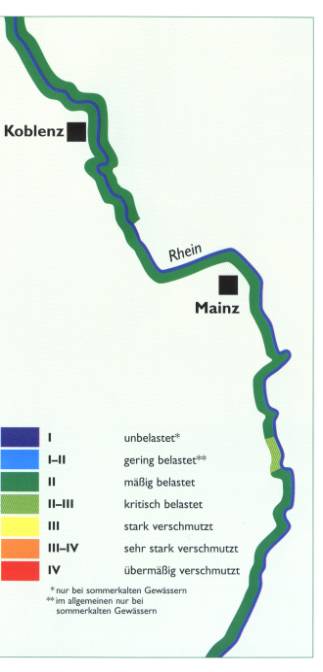|
||
|
|
Fische
gelten als Messgeräte für Wasserverschmutzungen, da es Fischarten
gibt, die sehr empfindlich auf bestimmte Chemikalien reagieren und
Gifte um eine weit höhere Konzentration als im Wasser in ihrem Körper
speichern. Da die Fische nur mit eingeschränkten Möglichkeiten vor
den gefährlichen Stoffen flüchten können, wirkt sich eine Veränderung
in erster Linie auf die Fische aus. In diesem Sinne ist es interessant
sich mit der veränderten Wasserqualität zu befassen.
Hier haben wir uns
auf die letzten 50 Jahre beschränkt, da wir von vorher keine schriftlichen
oder mündlichen Quellen gefunden haben.
In der Broschüre,
„Der Rhein Gestern, Heute, Morgen“ [1] wird die Entwicklung der
Wasserqualität des Rheins von 1947 bis 1997 dargestellt. In den Jahren, die unmittelbar
nach dem Krieg folgten, dachte man allein an das Überleben. Die Städte
waren verwüstet, Brücken waren zerstört und der Schiffsverkehr war
behindert. Die Menschen in Rheinland-Pfalz litten Not und noch bis
Ende der 50er Jahre herrschte Armut. Dadurch, dass Wirtschaft, Industrie
und Verkehr nur langsam wuchsen, gab es auch keine schwerwiegende
ökologische Belastung für den Rhein. Man konnte bedenkenlos in ihm
schwimmen und Fische sowie Kleinlebewesen gab es genügend.
[2] Bereits für 1955 lassen sich
punktuelle Belastungen nachweisen. Vor allem unterhalb der industriellen
Einleitungen registrierte man große Verschmutzungen. Zum Beispiel
wurden Säurehaltige Abwässer eingeleitet. Vorwiegend war die Gegend
um Mannheim und Ludwigshafen durch die Ableitungen der Zellstofffabriken
belastet, so dass sogar die Netze der Berufsfischer verstopften. Die
Firmen bezahlten den Fischern als Entschädigung Nylonnetze, die nicht
so leicht verstopften. Aber auch der Rheinabschnitt um Mainz war sehr
stark verschmutzt. Wiederaufbau und wirtschaftlicher Aufschwung standen
an erster Stelle, so dass sich niemand mit der Abwasserproblematik
befasste. Es gab noch keine Gesetze und Regelung zum Gewässerschutz. [3] Bis 1972 hatte sich der Rhein
zu einer Kloake entwickelt. Fischsterben war an der Tagesordnung und
die lebenden Fische waren ungenießbar, so dass sie von den Fischern
nur schwierig verkauft werden konnten. Im Jahre 1971 verendeten sogar
sämtliche Fische von der Mainmündung bis nach Köln. Die Belastung
war so hoch, dass es zeitweise im Rhein bei Koblenz gar keinen Sauerstoff
mehr gab. Die übermäßig verschmutzten Bereiche lagen zwischen Ludwigshafen
und Mainz. Nur einige Abwassertolerante Kleinlebewesen lebten noch
in diesem Abschnitt. [4]
Bereits seit den 60er Jahren gab das
Erscheinungsbild des Rheins Anlass zu erheblicher Sorge. Um den Zustand
der Gewässer darstellen zu können, wurde 1974 eine „Gewässergütekarte
der Bundesrepublik Deutschland“ eingeführt,
so dass Veränderungen festgestellt und bewertet werden konnten. Die
Qualität wird in sieben Stufen unterteilt:
Güteklasse
I= unbelastet bis sehr
gering belastet Güteklasse
I-II= gering belastet (große
Artenvielfalt) Güteklasse II= mäßig belastet
(sehr große Artenvielfalt) Güteklasse II-III= kritisch
belastet (noch ertragreiches Fischgewässer) Güteklasse III= stark verschmutzt
(mit periodischem Fischsterben ist zu rechnen) Güteklasse III-IV= sehr stark verschmutzt (Fische nicht auf Dauer
und dann nur örtlich begrenzt anzutreffen) Güteklasse IV = übermäßig verschmutzt (Fische fehlen; bei starker
toxischer Belastung biologische Verödung). [5]
Die Wasserbeschaffenheit des Rheins 1972. [6]
Bereits
schon 1976 schrieb die MAZ, dass der Sauerstoffgehalt bei mehr als
7 Milligramm pro Liter liegt, womit die Sättigungsgrenze erreicht
wurde und dass es seit 1972 in Rheinland- Pfalz 150 Kläranlagen gibt. [7] Auch wenn 1976 das Wasser im Rhein noch nicht
wieder gut war, so muß es zumindest etwas besser geworden sein. Bis 1984 wurden entscheidende Schritte
zur Verbesserung der Wasserqualität gemacht. Außer an einer kurzen
Strecke unterhalb von Ludwigshafen, war der Rheinabschnitt in Rheinland-Pfalz
nur noch mäßig belastet (Güteklasse II). |
|