In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie die Menschen in vergangenen und gewärtigen Zeiten den Pfau aus unterschiedlichen Blickwinkeln sahen, und was sie mit ihm in Verbindung brachten.
|
|
|
|
|
Das Rad des Pfaues ist Bild des gestirnten Firmaments, denn seine mit Augen überzogenen Federn erinnern an den Sternenhimmel. Bisweilen haben Engel als himmlische Wesen an ihren Flügeln Pfauenfedern (siehe „Verkündigung“ von Francessco Cossa 1470/72 Dresden GemGal)
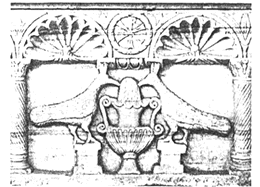 In der frühchristlichen Grabkunst wurden symmetrische Pfauen zu seiten eines Fruchtkorbes oder eines Trinkgefäßes abgebildet.
In der frühchristlichen Grabkunst wurden symmetrische Pfauen zu seiten eines Fruchtkorbes oder eines Trinkgefäßes abgebildet.
In der Antike war der Pfau das häufigste Symbol der Unsterblichkeit.
Seine nachwachsenden Federn
sowie die Haltbarkeit seines Fleisches machten ihn zum Symbol der Erneuerung,
Unsterblichkeit und Ewigkeit.
Bis ins Mittelalter bestand die Paradiessymbolik des Pfaus, die von der Gartenidyllik und Verwendung als Attribut der Juno stammt.
In den Grabmalereien wurde der Pfau als der schönste Vogel in römischen Gärten abgebildet. Die christliche Kunst übernahm diesen fülligen Garten als Paradies, in dem der Pfau lebt und aus dem Lebensbrunnen trinkt. Hier wird er als Seliger im Paradies dargestellt.
Auch im Sufismus ist der Pfau in der Paradiessymbolik wiederzufinden.
In der Religion der kurdischen Yeziden wird ein Engelpfau angebetet, der dort ursprünglich ein dualistischer Anti-Gott war, der durch monotheistischen Einfluss zum ersten Engel der Schöpfung wurde.
Neben dem heiligen Liborius
tragen auch die heilige Dorothea und Barbara die Pfauenfeder als
Attribut.
Die Eitelkeit des Pfaues
wegen des mit Augen geschmückten, kreisförmigen ausgebreiteten Gefieders
betonten antike und mittelalterliche Autoren. Daher wurde der Pfau im späten
Mittelalter Attribut von Hochmut und Eitelkeit.
 Wegen des prächtigen
Schwanzgefieders wird der Pfau stolz und eitel Dargestellt. Außerdem ist er ein
Symbol der Sonne, des Lebens und des Frühlings.
Wegen des prächtigen
Schwanzgefieders wird der Pfau stolz und eitel Dargestellt. Außerdem ist er ein
Symbol der Sonne, des Lebens und des Frühlings.
Im Mittelalter setzte sich allmählich eine negative Betrachtung des schönen Vogels durch. Nur in Antonius von Padua (13. Jahrhundert) findet er noch einmal einen Anwalt, der sagen kann: „ Bei der allgemeinen Auferstehung wird jener Pfau (der Leib), der die Federn der Sterblichkeit ablegte, das Gefieder der Unsterblichkeit erlangen.“
Aber dann wandelte sich
das Symbol der Lebensfreude, des Frühlings und der Unsterblichkeit zu einem
Sinnbild der Eitelkeit, des Stolzes, ja sogar des Teufels, der „schön scheint, sich aber durch seine missstimmende Stimme verrät“.
Nach dem Physiologus
freut sich der Pfau seiner Schönheit, schreit aber beim Anblick seiner
hässlichen Füße wie der Mensch wegen seiner Sünden.
Heute zeigen etliche
Sprichwörter diese negative Bedeutung des Pfaues :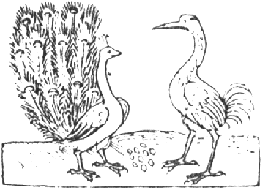
„Sich spreizen wie ein Pfau“
„Stolz wie ein Pfaues“
Auch gibt es lustige Beschreibungen des Pfaues, die diese Bedeutung unterstützen :
- Manche Männchen müssen halt eine große Show abziehen, damit die Frauen sich für sie interessieren...
- Ein blühendes
Huhn.
Auch das Gedicht von Kurt Tucholsky zeigt einen eitlen Pfau :
Ich bin ein Pfau.
In meinen weißen Schwingen
fängt sich das Schleierlicht der Sonne ein.
Und alle Frauen, die vorübergingen,
liebkosten mit dem Blick den Silberschein.
Ich weiß, dass ich sehr schön bin.
Meine Federn auf meinem Kopf stell ich oft kapriziös ...
Ich hab das weißeste von allen Pfauenrädern;
ich bin sehr teuer, selten und nervös.
Ich habe leider ziemlich große Krallen,
und wenn ich fliege, sieht es kläglich aus.
Doch, wer mich liebt, dem werde ich gefallen,
und alle Welt steht vor dem Vogelhaus.
Klug bin ich nicht. Klugheit ist nicht bei allen,
viel liegt nicht hinter meiner Vogelstirn.
Ich will gefallen - immer nur gefallen -
Ich bin ein schöner Pfau. Ich brauche kein Gehirn.
Nur singen darf ich nicht. Das ordinäre
Gekrächz ist nicht zu sehen - wie mein Bildnis zeigt.
Ich bin ein Pfau.
Und eine schöne Lehre:
Wer dumm und schön ist,
setzt sich. Siegt. Und schweigt.
Der indische Traum vom goldfarbenen Pfau, dessen Fleisch immerwährende Jugend und Unsterblichkeit gewähre, kam mit dem Tier wohl auch in die Länder des Mittelmeerraumes.
Augen haben angeblich magische Kraft.
Im Heilzauber sollen sie Dämonen und Melancholie vertreiben.
Mit dem Glauben an den bösen Blick hängt es zusammen, wenn man Pfauenfedern als Zimmerschmuck und im Theater vermeidet: Sie bringen Unglück und ehelichen Zwist ins Haus, ferner ziehen sie den Blitz an.
Anderseits wird die
dämonenabwehrende Kraft des Pfauenfederspiegels im Heilzauber ausgiebig verwertet.
Perser und Türken tragen die Federn in der Stirnbinde, wenn
sie von Pocken und Masern befallen werden.
In
Deutschland trägt man gegen angezauberte Melancholie eine in ein seidenes rotes
Flecklein genähte Haselnuss um den Hals, in deren Höhlung man einen
Pfauenfederspiegel und etwas Quecksilber getan hat.
Damit das Kind leicht zahne, legt man ihm Pfauenfedern ins
Bett.
Das
Einnehmen eines fein zerschnittenen Pfauenfederspiegels hilft gegen
Bräune.
Zu Asche verbrannt und mit Lindenblütenwasser getrunken,
fördern die Federn den Stuhlgang bei Kindern.
Pfauenfedern, in Bier gekocht, gibt man Frauen ein, die an bösen Brüsten leiden.
Der
Rauch verbrannter Federn wirkt Nerven belebend und hilft gegen Seitenstechen,
Augentriefen und „für den Fuß Haimligkeit“.
Bemerkenswert ist der Glaube, dass der Hirsch nicht aus
einem Kreise heraustrete, der mit einer angezündeten Pfauenfeder gezogen
wird.
Die Galle des Vogels wird gegen Augenleiden verwendet.
Das Schmalz mit Rautensaft und Honig „benimpt das Darmgicht, so von kalter feüchte kommen“.
Der Kot hilft gegen Epilepsie.
Kot
hilft auch gegen Fußleiden sowie Zittern der Glieder oder des ganzen
Körpers.
Gegen Schwindel genieße man das Pulver von Fleisch des
Pfaues oder dessen Gehirn.
Das Schreien des Pfaues kündigt Regen an.
Das Schreien des Pfaues zu außergewöhnlicher Zeit ist nach
deutschem Volksglauben todverkündend.
Der
Komet wird auch als Pfauenschwanz bezeichnet.
Eine mohammedanische Sage berichtet, dass der Pfau seine liebliche Stimme erst verlor, als er zugleich mit der Schlange und dem ersten Menschenpaar aus dem Paradies vertrieben wurde.