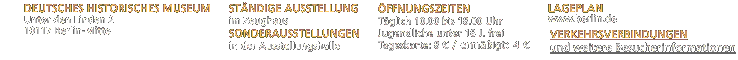Filminhalte November | Dezember
SONDERVERANSTALTUNG
Podiumsdiskussion:
“Europa” im
Ostblock. Vorstellungswelten und Kommunikationsräume
im Wandel
am 03.11.2005 um 17.00 Uhr
One Day
In Europe
D/ E 2005, R: Hannes Stöhr,
D: Megan Gay, Florian Lukas, Erdal Yildiz, Rachida
Brakni, 100’
Eine englische Geschäftsfrau und eine russische
Rentnerin in Moskau, ein Berliner Rucksacktourist
und ein schwäbischer Taxifahrer in Istanbul,
ein ungarischer Pilger und ein galizischer Polizist
in Santiago de Compostela, ein französisches
Straßenkünstlerpaar in Berlin –
sie alle werden in Gepäckdiebstähle
verwickelt. Es ist der Tag des Championsleague-Finales
zwischen Galatasaray Istanbul und Deportivo La
Coruña in Moskau. Überall herrscht
Fußballfieber, den Euro gibt es auch schon.
Nur mit der Verständigung ist es manchmal
ganz schön schwierig...
Regisseur Hannes Stöhr erzählt in seinem
episodischen Geflecht warmherzig und neugierig,
mit wunderbarer Leichtigkeit von Menschen in Europa,
von Begegnungen und Missverständnissen, vom
Reisen, Ankommen und Aufbrechen – und von
der Möglichkeit, sich nahe zu kommen.
Wie die erzählten Geschichten, ist auch die
Entstehung des Films mit verblüffender Selbstverständlichkeit
gesamteuropäisch. Den Kern der Filmcrew um
Hannes Stöhr, die Produzentinnen Anne Leppin
und Sigrid Hoerner, Florian Hoffmeister (Kamera),
Frank Kruse (Ton), Daniela Selig (Kostüm),
Andreas Olshausen (Ausstattung) und Simone Arndt
(Produktionsleitung) komplettierten vier Teams
aus Moskau, Istanbul, Galizien und Berlin. Entstanden
ist One Day In Europe als Produktion der Berliner
moneypenny filmproduktion, in Koproduktion mit
workshop, der spanischen filmanova, ZDF –
Das kleine Fernsehspiel, ARTE und Televisión
de Galicia.
In Zusammenarbeit mit dem Zentrum Zeithistorische
Forschung, Potsdam
am 03.11.2005 um 19.00 Uhr
Eintritt frei für beide Veranstaltungen
WIEDERENTDECKT
DEFA-Wochenschau „Der
Augenzeuge“ Nr. 96 /1948
Regisseur Gustav von Wangenheim bei Dreharbeiten
zu „Und wieder 48“
Und wieder
48
Sowjetische Besatzungszone Deutschlands
(SBZ) 1948, R: Gustav von Wangenheim, D: Inge
von Wangenheim, Ernst Wilhelm Borchert, Lotte
Loebinger, 102’
Historische Jubiläen waren in Ost und West
stets willkommene Anlässe, Geist und Bedeutung
des berufenen Ereignisses für sich zu vereinnahmen
und die Erinnerung daran so zu inszenieren, dass
die Historie der Gegenwart Recht und damit Kredit
für die Zukunft gab.
Im Nachkriegs-Ostdeutschland organisierte man
1948 eine medial breit angelegte Erinnerung an
die früh-revolutionären Ereignisse von
1848: soziale Unruhen als erste Anzeichen der
stürmisch beginnenden industriellen Entwicklung
in Deutschland und als Keime gesellschaftlicher
Veränderungen. Sie manifestierten sich als
scharfer Gegensatz zwischen monarchischem und
bürgerlichem Denken.
Im dritten Jahr nach Kriegsende war in Ostdeutschland
die Berufung darauf nicht ohne tiefere Bedeutung:
die beginnende Stalinisierung der SBZ stand merklich
allen frühbürgerlich-demokratischen
Forderungen nach Meinungsvielfalt entgegen. Autor
und Regisseur Gustav von Wangenheim hatte bereits
in den 30er Jahren im sogenannten „Schlöffel“-Stoff
die Figur eines jungen, wortgewandten Studenten-Journalisten
fabuliert, der in den Wirren jenes Jahres 1848
in Berlin mutig, lebhaft und erfolgreich für
die Ideale von Meinungsfreiheit und Offenheit
eintritt. Wangenheims Texte lassen sich auch als
Versuche lesen, im Moskauer Exil wenigstens für
sich selbst den Stalinschen Terror durch Beschwörung
frühbürgerlicher Ideale zu unterlaufen.
Mit dem DEFA-Film nutzte er nun - durchaus öffentlichkeitswirksam
- die Konjunktur des hundertsten Jahrestags, um
seine Version vorzulegen, die freilich nur soweit
gehen konnte, wie Ideologie und Zensur in der
SBZ es gestatteten.
Eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit
CineGraph Babelsberg und dem Bundesarchiv-Filmarchiv.
Einführung: Günter
Agde
am 04.11.2005 um 19.00 Uhr
AMERICAN FILM NOIR
Laura
USA 1944, R: Otto Preminger,
D: Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent
Price, 88’ OF
Bereits in seinem ersten Film Noir offenbaren
sich die speziellen Stärken Premingers, der
ausgezeichnete Charakterstudien mit komplizierten,
anspruchsvollen Handlungsstoffen zu verbinden
weiß.
Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Großstadtdetektiv,
der in einem Mord an einer erfolgreichen Geschäftsfrau
ermittelt. Die Erkenntnisse und Spuren passen
aber nicht zusammen. Tatsächlich taucht die
vermeintlich Tote eines Tages auf. Eine andere
Frau wurde an ihrer Stelle ermordet, und ihr eigenes
scheinbares Ableben ist der genau kalkulierte
Teil eines Mordplanes. Den allerdings kann der
Detektiv in letzter Minute durchkreuzen.
„Die Noir-Sprache, das Vokabular der Rückblenden,
Kameragleitfahrten, ins Dunkel sich öffnende
Türen, der Spiegel und Gitterschatten, beherrscht
Otto Preminger kongenial wie seine besten Kollegen.
Seine Kühle indes, seine Eleganz und sein
Wille zum Stil sind in der Schwarzen Serie singulär
geblieben.“ (Harry Tomicek)
am 04.11.2005 um 21.00 Uhr
FORMEN DER ERINNERUNG
NATIONALSOZIALISMUS IM FILM
Fünf letzte
Tage
BRD 1983, R: Percy Adlon, D:
Lena Stolze, Irm Hermann, Willi Spindler, Hans
Hirschmüller, 112’
Zum 40. Todestag der Geschwister Scholl im Februar
1983 gab das Bayerische Fernsehen einen Film zum
Themenkreis der "Weißen Rose"
in Auftrag, dessen Sichtweise dann ideal den gerade
abgedrehten Film Die Weiße Rose von Michael
Verhoeven ergänzen sollte. Mit Lena Stolze
als Sophie Scholl ist für Percy Adlons Fünf
letzte Tage die gleiche Besetzung der Hauptfigur
gewählt worden.
Als Zellengenossin im Gestapogefängnis erlebt
die Buchhalterin Else Gebel die letzten fünf
Lebenstage der einundzwanzigjährigen Studentin
Sophie Scholl, die am 18. Februar 1943 zusammen
mit ihrem Bruder Hans in der Münchner Universität
verhaftet und am 22. Februar wegen Hochverrats
durch das Fallbeil hingerichtet wurde. Der Film
übernimmt ganz die Erzählperspektive
der Else Gebel.
Adlon hat es sich sehr schwer mit diesem Film
gemacht; er nahm den Auftrag erst an, als er sicher
war, einen Ansatz gefunden zu haben, nämlich
die Zeugin Else Gebel, die nach dem Krieg in einer
kleinen Schrift ihre Erinnerungen festgehalten
hat. Mit Else Gebel war ein Gegenüber gefunden,
eine Person, mit der Sophie Scholl sprechen und
der sie sich öffnen konnte. Mit fast dokumentarischer
Genauigkeit sind hier Dialoge zusammengesetzt
worden. Das lässt auch der fertige Film spüren,
der eine sehr strenge distanzierte Spiel-Dokumentation
geworden ist.
am 05.11.2005 um 19.00 Uhr
am 13.11.2005 um 21.00 Uhr
Sophie Scholl.
Die letzten Tage
D 2005, R: Marc Rothemund, D:
Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander
Held, Johanna Gastdorf, André Hennicke,
115’
„Bald werden Sie stehen, wo ich jetzt stehe".
Diese Worte richtet Sophie Scholl (Julia Jentsch)
an Richter Roland Freisler (André Hennicke)
als sie im Februar 1943 auf der Anklagebank des
Volksgerichtshofes steht. Die junge Studentin
und ihr älterer Bruder Hans (Fabian Hinrichs)
wurden Tage zuvor von der Gestapo verhaftet. Die
Geschwister haben in der Münchner Universität
Flugblätter gegen die nationalsozialistische
Regierung verteilt. Nach ihrer Festnahme wird
Sophie Scholl fast eine Woche lang von Robert
Mohr (Gerald Alexander Held) verhört. Die
neuentdeckten Verhörprotokolle liegen hier
der Inszenierung zu Grunde. Das „Duell“
der Studentin mit dem Gestapo-Mann gehört
zu den intensivsten Momenten des Films. Anfangs
leugnet Sophie, aber die Schlinge belastender
Beweise zieht sich immer enger um sie. Schließlich
gesteht sie, beteuert aber, stolz auf ihr Engagement
zu sein. Sie wird mit ihrem Bruder und einem weiteren
Mitglied der Gruppe hingerichtet.
am 05.11.2005 um 21.00 Uhr
am 13.11.2005 um 19.00 Uhr
Rosenstraße
D/ NL 2003, R: Margarethe von
Trotta, D: Katja Riemann, Maria Schrader, Martin
Feifel, Jürgen Vogel, Jutta Lampe, 135’
Der Film über den Protest Berliner Frauen
gegen die Verhaftung ihrer „jüdischen
Männer“ hat viele Diskussionen über
die filmische und künstlerische Aufbereitung
von historischen Ereignissen aus der Zeit des
Nationalsozialismus und ihre historischen Korrektheit
ausgelöst.
Nach dem Tod ihres Vaters, will Hannah Weinstein
(Maria Schrader) endlich mehr über die Vergangenheit
ihrer jüdischen Mutter Ruth (Jutta Lampe)
erfahren. Die trauernde Witwe hat Zeit ihres Lebens
nie ein Wort über ihre dramatischen Erlebnisse
im Berlin der 40er Jahre verloren und bleibt auch
jetzt noch verschlossen. Aus diesem Grund bricht
Hannah kurz entschlossen zu einer Reise in die
deutsche Hauptstadt auf, um die Wurzeln ihrer
Mutter selbst aufzuspüren. Tatsächlich
trifft sie vor Ort auf die mittlerweile 90-jährige
Lena Fischer (Doris Schade), die als junge Frau
(Katja Riemann) Hannahs Mutter vor den Nazis versteckt
hielt. Lena erzählt Hannah ihre wundersame
Geschichte über ihren gewaltlosen Widerstand
gegen das Hitler-Regime und die tapferen Frauen
der Rosenstraße…
am 06.11.2005 um 18.30 Uhr
Die weiße Rose
BRD 1982, R: Michael Verhoeven,
D: Lena Stolze, Wulf Kessler, Oliver Siebert,
Ulrich Tukur, 123’
Am 22. Februar 1943 wurden Sophie Scholl, ihr
Bruder Hans und beider Freund Christoph Probst
in München hingerichtet, nur vier Tage nach
ihrer Verhaftung und noch am Tag des Prozesses,
zu dem der berüchtigte Nazirichter Freisler
eigens aus Berlin angereist war.
Michael Verhoeven erzählt die Geschichte
der "Weißen Rose" vom Sommer 1942,
als Sophie Scholl zum Studium nach München
kommt, bis zum Februar 1943. Er tut das auf eine
sehr nüchterne, differenzierte Weise, er
idealisiert die Widerstandsgruppe nicht, er zeigt
ihre Zweifel und Ängste, ihre Konflikte.
Er stützt sich dabei auf genaue historische
Recherchen sowie auf Briefe und Tagebucheintragungen
von Hans und Sophie Scholl.
„Verhoeven macht in seiner Rekonstruktion
Schluss mit verklärenden oder diffamierenden
Thesen über die Gruppe, er befreit sie vom
Ruch des politischen Sektierertums und der schwärmerischen
Todessehnsucht und deutet das Handeln dieser jungen
Leute als klare politische Vernunft. Die Aktualität
des Themas Widerstand ist ungebrochen und der
kritische Ansatz gegen Ja-Sager, schweigende Intellektuelle
und Mitläufer noch immer von Bedeutung."
(Hubert Haslberger, film-dienst)
Filmgespräch mit Lena Stolze
am 06.11.2005 um 21.00 Uhr
Der Untergang
D 2004, R: Oliver Hirschbiegel,
D: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch,
Ulrich Matthes, Heino Ferch, 150’
Lange Jahre trug sich Bernd Eichinger mit dem
Gedanken, einen Film über das Dritte Reich
zu produzieren. Mit Joachim Fests Buch „Der
Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches“
und Traudl Junges Aufzeichnungen „Bis zur
letzten Stunde. Hitlers Sekretärin erzählt
ihr Leben“ fand er schließlich den
idealen Stoff.
Dass in diesen Film Hitler als dramatisches Zentrum
der Handlung dient, erklärt vielleicht die
Aufregung, die letztes Jahr um diesen Film herrschte.
Es geht um die letzten Tage des Dritten Reiches,
um die bizarren Ereignisse im Führerbunker
kurz vor der totalen Kapitulation im Mai 1945.
Erzählt wird aus der Perspektive der jungen
naiven Traudl Junge, Hitlers Sekretärin.
Sie erzählt davon, wie sie immer dachte,
in jungen Jahren wäre sie schlicht zu naiv
gewesen, um etwas zu wissen von den Dingen, die
geschahen, und sie erzählt von dem Schock,
den sie erlebte, als sie vor einem Sophie-Scholl-Denkmal
erkennen musste, dass jene bei ihrer Hinrichtung
genauso alt war wie sie zu Beginn ihrer Zeit als
Hitlers Sekretärin. Ihre Erlebnisse sind
der rote Faden in diesem gespenstischen Spektakel.
am 10.11.2005 um 19.00 Uhr
am 11.11.2005 um 21.00 Uhr
Im toten Winkel:
Hitlers Sekretärin
A 2002, R: André Heller,
Othmar Schmiderer, 90’
Traudl Junge (1920-2002) war von 1943 bis zum
Zusammenbruch der Naziherrschaft eine der Privatsekretärinnen
von Adolf Hitler. Sie arbeitete für ihn im
Führerhauptquartier in der Wolfsschanze,
im Berghof am Obersalzberg, im Sonderzug und in
Berlin. 1944 wurde sie Zeugin des missglückten
Stauffenberg-Attentats, die letzten Kriegstage
und den Selbstmord Hitlers erlebte sie im Führerbunker
der eingekesselten Hauptstadt. Traudl Junge war
es auch, der Hitler sein Testament diktierte.
Die Gespräche zum Film zwischen André
Heller und Traudl Junge kamen im Jahr 2001 durch
Vermittlung der Autorin Melissa Müller zustande,
die zu dieser Zeit an der Herausgabe und Einleitung
der von Traudl Junge bereits 1947 niedergeschriebenen
Erinnerungen arbeitete. Othmar Schmiderer, der
die Gespräche mit der Kamera aufzeichnete,
wählte eine filmische Herangehensweise, die
von wenigen Kameraeinstellungen und dem Verzicht
auf zusätzliches Kunstlicht ausging. Er selbst
war für Kamera und Ton verantwortlich, da
so während der Begegnungen mit Traudl Junge
der ausgestellte Charakter eines Filminterviews
vermieden werden konnte.
Traudl Junge berichtet von der täglichen
Routine im inneren Kreis von Hitlers Umgebung,
von Tagesabläufen, deren freundliche Banalität
in absurdem Widerspruch zur Vernichtungspolitik
des NS-Regimes stand.
am 10.11.2005 um 22.00 Uhr
am 11.11.2005 um 19.00 Uhr
CINEFEST
MEHRSPRACHENVERSIONEN
Der blaue
Engel
englische Version: The Blue Angel
D 1930, R: Josef von Sternberg,
D: Emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron,
Rosa Valetti, 107’ dt. OF und engl. OF
Josef von Sternberg benutzt den im Jahr 1905
erschienenen Roman „Professor Unrat“
von Heinrich Mann zu einer Parabel auf die heuchlerische
Moral des Kleinbürgertums: Der strenge Gymnasialprofessor
Immanuel Rath (Emil Jannings) verliebt sich in
die Sängerin Lola-Lola (Marlene Dietrich).
Er wird aus dem Schuldienst entlassen und gerät
in eine demütigende Abhängigkeit zu
ihr. Rath heiratet sie und geht mit ihr auf Tournee.
Zum dummen August herabgewürdigt, wird er
von Lola verlassen, die den Avancen des Artisten
Mazeppa (Hans Albers) nachgibt.
Josef von Sternberg drehte für die Ufa eine
deutsche und eine englische Fassung - The Blue
Angel. Damit beginnt für Marlene Dietrich
eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sternberg.
Noch im Jahr der Premiere des Films geht sie nach
Hollywood, wo sie für die Paramount unter
seiner Regie in sieben Filmen den mondänen
Vamp spielt.
„Die in Deutschland hergestellte englische
Version enthält in gemischter Form englische
und deutsche Dialoge und Liedertexte. Sie weist
zum Teil andere Einstellungen auf.“ (U.
Klaus: Deutsche Tonfilme)
am 17.11.2005 um 19.00 Uhr und am
04.12 um 21.00 Uhr deutsche Version
am 18.11.2005 um 21.00 Uhr englische Version
Baby
F/ D 1932, R: Carl Lamac, D: Anny Ondra, Albert
Paulig, Lotte Spira, Adolf Wohlbrück, 81’
dt. OF
In diesem frühen Tonfilm ist Anny Ondra
„Baby“, eine achtzehnjährige
Komtesse, die ihren gräflichen Eltern durch
ihre „revolutionären Manieren"
– so die Mutter – große Sorgen
macht. So kommt es zu dem Entschluss der Eltern,
„Baby" in ein Internat nach England
zu schicken, damit sie endlich „etwas Anständiges"
lernt.
Auch Suzette, ihre Freundin vom Varieté,
Tochter des Requisiteurs und einer ehemaligen
Kunstreiterin, soll nach England verfrachtet werden.
Bei den berühmten „Singing Babies"
soll sie zur Sängerin und Tänzerin ausgebildet
werden, um endlich ein Star zu werden. Auf der
Überfahrt nach England werden die beiden
von Lord Cecil und Lord James beobachtet. Beide
nehmen an, dass das blonde und kapriziöse
Baby Suzette heißt, und die vornehme dunkelhaarige
Komtesse Lafitte. Den beiden Mädchen gefällt
diese Verwechslung sehr gut, denn es kommt ihren
natürlichen Talenten sehr entgegen. So geht
die wirkliche Suzette ins Pensionat, denn sie
ist lernbegierig, und Baby landet bei den "Singing
Babies" und wird bald zum Star in einer kessen
Hosenrolle.
Der Film wurde 1932 als deutsche Version der französischen
Originalfassung von Pierre Billon und Carl Lamac
in den Pathé-Studios in Paris hergestellt.
am 17.11.2005 um 21.00 Uhr
am 18.11.2005 um 19.00 Uhr
Murder!
Deutsche Version: Mary. Sir
John greift ein
D/ GB 1930, R: Alfred Hitchcock,
D: Herbert Marshall, Norah Baring, Phyllis Konstam,
Edward Chapman, 92’ engl. OF
D/ GB 1930, R: Alfred Hitchcock, D: Alfred Abel,
Olga Tschechowa, Paul Graetz, Lotte Stein, 92’
dt. OF
Die junge Schauspielerin Diana wird in einem
Indizienprozess als angebliche Frauenmörderin
zum Tode verurteilt. Einer der Geschworenen, der
Theaterautor Sir John Menter, glaubt jedoch an
ihre Unschuld und beginnt daher auf eigene Faust
zu ermitteln. In der Theatertruppe der Verurteilten
entdeckt er den wahren Mörder und kann ihn
– dank seiner Kenntnisse des „Hamlet“
– überführen.
Der als deutsch-englische Co-Produktion entstandene
Film wurde in zwei Fassungen gedreht; die deutsche
Version mit Olga Tschechowa trug den Titel Mary.
Sir John greift ein. „Vor Beginn der Dreharbeiten
bin ich [Hitchcock] also nach Berlin gefahren,
um über das Drehbuch zu sprechen. Man schlug
mir viele Änderungen vor, die ich alle abgelehnt
habe. Doch das war ein Fehler. Ich habe abgelehnt,
weil ich mit der englischen Fassung zufrieden
war und aus wirtschaftlichen Erwägungen.
Man konnte nicht zwei Fassungen drehen, die zu
verschieden von einander waren. Ich bin also mit
dem unveränderten Drehbuch nach London zurückgefahren
und habe mit den Dreharbeiten begonnen. Ich habe
sofort gemerkt, dass ich kein Ohr für die
deutsche Sprache hatte. Alle möglichen Details,
die in der englischen Fassung sehr komisch waren,
waren es überhaupt nicht mehr in der deutschen.
Zum Beispiel die ironischen Seitenhiebe auf den
Verlust der Würde oder auf Snobismus. Der
deutsche Schauspieler fühlte sich nicht wohl
in seiner Haut, und ich merkte, ich verstand die
Besonderheiten des Deutschen nicht:“ (Alfred
Hitchcock)
am 19.11.2005 um 19.00 Uhr und am
24.11.2005 um 21.00 Uhr englische Version
am 20.11.2005 um 21.00 Uhr und am 24.11.2005 um 19.00
Uhr deutsche Version
Hans in allen Gassen
(Deutsche Version von: La
folle aventure)
D 1930, R: Carl Froelich, André-Paul Antoine,
D: Jean Murat, Marie Glory, Marie Bell, Silvio
de Pedrelli, 99’ dt. OF
„Der rasende Reporter Hans Steindecker
wird Zeuge eines spektakulären Mordes vor
dem Portal des Völkerbund-Palastes. Als er
jedoch die Bekanntschaft einer weinenden Frau
macht, scheint alles vergessen. Als ihn die Unbekannte,
die sich als Nelly vorstellt, darum bittet, sie
mit seinem Auto über die Grenze zu bringen,
sagt Hans bedenkenlos zu. Obwohl sich Hans dadurch
verdächtig macht, verhilft er Nelly, die
keine Papiere besitzt, über Umwege nach Berlin
zu gelangen. Dort sucht sie den Vater von Hans
auf, der ihr ebenfalls zur Flucht verhelfen soll.
Hans, dessen Ruf inzwischen stark angekratzt ist,
beginnt nun mit seinem alten journalistischen
Eifer, Licht ins Dunkel zu bringen. Die Spur führt
nach Nizza zu einem gewissen Soranzo, der mit
Nelly verheiratet ist und mit dem Mord offensichtlich
in Verbindung steht...“ (Jan-Eric Loebe)
am 19.11.2005 um 21.00 Uhr
am 20.11.2005 um 19.00 Uhr
SOS Eisberg
(Amerikanische Version: SOS Iceberg)
D 1933, R: Arnold Fanck, D:
Leni Riefenstahl, Gustav Diessl, Ernst Udet, Sepp
Rist, 103’ dt. OF
Professor Lorenz/Lawrence (Gustav Diessl/Rod
La Rocque) gilt seit einer Forschungsreise als
verschollen. Neue Hinweise aber lassen vermuten,
dass er doch noch lebt. Der damalige Expeditionsleiter
(Sepp Rist) unternimmt daher eine Erkundungsfahrt
nach Grönland. Tatsächlich findet man
Lorenz/Lawrence in einer Eishöhle auf einem
treibenden Eisberg. Doch Retter und Geretteter
befinden sich in einer ausweglosen Situation,
da der Eisberg langsam auseinander bricht. Immerhin
gelingt es, über Funk die Weltöffentlichkeit
um Hilfe zu bitten. Flugpiloten machen sich auf
den Weg, unter ihnen die Sportfliegerin und Frau
von Lorenz/Lawrence, Hella/Ellen (Leni Riefenstahl).
Doch die Flugzeuge gehen zu Bruch. Innerhalb der
Mannschaft machen sich Hunger, Panik und Psychosen
breit – bis endlich Rettung am Himmel naht…
In Co-Produktion mit der Universal Pictures entstand
unter der gemeinsamen Regie mit Tay Garnett eine
leicht veränderte amerikanische Fassung des
Films.
Im Vorprogramm Ausschnitte der amerikanischen
Version: S.O.S. Iceberg
am 25.11.2005 um 19.00 Uhr
am 26.11.2005 um 21.00 Uhr
F. P. 1 antwortet
nicht
(Englische Version: Secrets of F. P. 1)
D 1932, R: Karl Hartl, D: Hans
Albers, Sybille Schmitz, Paul Hartmann, Peter
Lorre, 114’ dt. OF
Kapitänleutnant a.D. Droste plant den Bau
einer großen Plattform mitten im Atlantik,
wo Flugzeuge auf ihrem Weg von Kontinent zu Kontinent
landen und auftanken können. Bei der Realisation
der Flugplattform 1 (F. P. 1) helfen ihm der Ozeanflieger
Ellissen (Hans Albers) und Claire Lennartz (Sybille
Schmitz). Nach zwei Jahren steht die künstliche
Insel, doch Konkurrent Damsky schleicht sich an
Bord, betäubt die Besatzung mit Gas und versucht,
die Insel zu versenken. Ellissen und Claire können
die Sabotage gerade noch im letzten Moment verhindern.
Karl Hartl drehte parallel noch eine französische
und eine englische Version, wobei die Rollen von
Hans Albers und Sybille Schmitz in der französischen
Fassung von Charles Boyer und Danièle Parola
und in der englischen von Conrad Veidt und Jill
Esmond übernommen wurden.
Im Vorprogramm Ausschnitte der englischen Version:
Secrets of F. P. 1
am 25.11.2005 um 21.00 Uhr
am 26.11.2005 um 19.00 Uhr
Flüchtlinge
D 1933, R: Gustav Ucicky, D:
Hans Albers, Käthe von Nagy, Eugen Klöpfer,
Ida Wüst, 88’
"Hans Steinhhoffs Hitlerjunge Quex und Gustav
Ucickys Flüchtlinge waren 1933 die einzigen,
allerdings wegweisenden Tributleistungen der Ufa
an die Propagandamaschinerie der neuen Machthaber.
(...) Hans Albers spielte die Hauptrolle, einen
deutschen Offizier, der sich 1928 >verbittert
und angewidert von der Knechtseligkeit der deutschen
Republik< (Programmheft der Ufa 1933), nach
Ostasien absetzt und in den Kriegswirren der Mandschurei
einer Gruppe von Wolgadeutschen zur Flucht in
die Heimat verhilft.
Dieses Filmwerk ist vom 'neuen Geist' getragen,
denn es verkörpert die hohen sittlichen Ideen
der Selbsthilfe und des Führerprinzips<
schrieb Oskar Kalbus, und die Repräsentanten
des >neuen Geistes< zeigten ihre Dankbarkeit:
Flüchtlinge erhielt das Prädikat >Künstlerisch
besonders wertvoll< und wurde am 1. Mai 1934
als erster Film mit dem neuen Staatspreis ausgezeichnet."
(Klaus Kreimeier)
Ucicky drehte mit dem Co-Regisseur Henri Chomette
etwas zeitversetzt eine französischsprachige
Version Au bout du monde.
am 27.11.2005 und 04.12.2005 jeweils
um 19.00 Uhr
Die Privatsekretärin
D 1930, R: Wilhelm Thiele, D:
Renate Müller, Hermann Thimig, Felix Bressart,
Ludwig Stössel, 37’ (Fragment, ursprünglich
85’)
„Es ist schwer zu sagen, warum das Filmlustspiel
Die Privatsekretärin ein so großer
Erfolg wurde. Die einen sagen, es liege an den
Schlagern (…), die anderen waren in die
kleine Stenotypistin Renate Müller verliebt,
die herzerfrischend und glückselig durch
ihre Sonntage trällert (…); die Filmliteraten
dagegen buchen den Erfolg auf den Stoff, der endlich
einmal einen ganz einfachen Ausschnitt aus dem
Alltagsleben bringt: eine kleine Stenotypistin
lernt durch eine Überstunde im Büro
ihren Chef kennen, den sie aber für einen
simplen Angestellten hält.“ (Oskar
Kalbus, 1935)
Die Musik dient in diesem Filmen nicht nur der
Untermalung, sondern ist – wie auch die
Lied- und Tanzeinlagen – in die filmische
Handlung einbezogen. Thiele nimmt damit schon
wesentliche Elemente des später in Hollywood
sehr populären Filmmusicals vorweg. Renate
Müller hatte eine Gesangsausbildung, die
der Vorliebe des frühen Tonfilms für
Gesangseinlagen sehr entgegen kam: Das Lied "Ich
bin ja heut' so glücklich" aus dem Film
wurde zum Schlager, Renate Müller selbst
zum Idealtyp des sauberen jungen Mädchens.
Sunshine Susie
englische Version von: Die
Privatsekretärin
GB 1931, R: Victor Saville,
D: Renate Müller, Owen Narres, Jack Hulbert,
Sybil Grove, 80’
Sunshine Susie ist Renate Müller, die auch
in der englischsprachigen Version der Privatsekretärin
die Hauptrolle übernommen hat. Sie spielt
ein junges Mädchen, das nach Berlin kommt,
um sein Glück zu suchen. Sie stellt sich
beim Personalchef einer Bank vor. Dieser stellt
sie ein, erhofft sich aber vor allem ein privates
Stelldichein mit der attraktiven Frau. Doch sie
verliebt sich nichts ahnend in den jungen Bankdirektor,
den sie für einen einfachen Kollegen hält.
Nach einigen Verwicklungen schwören sich
die beiden ewige Liebe.
Hier sind die Songs „Ich bin ja heut’
so glücklich“, „Mein Herz sagt
ja, doch der Verstand sagt nein“ und „Ich
hab’ ne alte Tante, die pump’ ich
immer an“ des Komponisten Paul Abraham auf
Englisch zu hören.
am 27.11.2005 um 21.00 Uhr
am 08.12.2005 um 19.00 Uhr
DEUTSCHES KULTURFORUM ÖSTLICHES
EUROPA:
HOMMAGE AN VOLKER KOEPP
Kalte Heimat
D 1995, R: Volker Koepp, 157’
„Kalte Heimat“ nennt Johannes Bobrowski
Ostpreußen. Koepp, der den Dichter 1972
porträtierte (Grüße aus Sarmatien),
wählt diese Verszeile als Filmtitel und fragt
Interviewpartnerinnen, ob sie wissen, woher die
Bezeichnung stammt. Eine Frau antwortet, dass
es eben so kalt hier sei, die Winter über
die Jahre jedoch an Intensität abgenommen
haben, eine andere Frau behauptet das Gegenteil
und sagt, dass alle Bewohner der Gegend aus ihren
früheren Heimaten den Frost mitgenommen haben.
Solche Ironie am Rande trifft ins Herz der Sache:
den Nomadismus des Jahrhunderts zu bestimmen,
der die Menschen der Region Kaliningradskaja Oblast
umtrieb und noch weitertreiben wird.
„>Finden statt erfinden<: Als Maxime
für dokumentarisches Arbeiten klingt das
so einfach, so selbstverständlich. Doch kaum
ein Filmemacher hat heute den Mut, sich der Welt
„unvorbereitet“ auszusetzen, ohne
Absichten, Plan, Zettelkasten. Die meisten Leute
misstrauen inzwischen der Welt, „wie sie
ist“. Sie halten sie für an sich langweilig.
Aber Volker Koepp bringt es immer noch fertig,
einfach irgendwohin zu fahren mit Kamera und Ton,
sich in aller Ruhe anzuschauen, was es da zu sehen
gibt.“ (Bernhard Sallmann) „Er will
die Menschen, die er filmt, zum Leuchten bringen“,
beschreibt Kraft Wetzel Koepps Herangehensweise.
am 28.11.2005 um 20.00 Uhr
Gustav
J.
BRD 1973, R: Volker Koepp, 21’
Gustav Jurkschat, achtzig Jahre alt, aus Litauen
stammend, erzählt sein Leben. Ein einfacher
Mann, der Zweite Weltkrieg verschlug ihn nach
Doberan, hier lebt er nun, hat drei Söhne,
ist in all den Jahren seiner Arbeit nachgegangen,
hat sich wohl von Zeit zu Zeit an die Vergangenheit
erinnert, das Leben fließt für ihn
ruhig dahin. Gustav berichtet gerne.
Im Film geschieht nichts überhastet. Die
Kamera (Christian Lehmann) lässt Gustav viel
Raum. Lange, ruhige Einstellungen drücken
das Wesen des Mannes aus – Gustav betrachtet
sich, sein Leben, die Welt, seine Umgebung.
Die Gilge
D 1998, R: Volker Koepp, 74’
Das nördliche Ostpreußen ist nach
dem Zweiten Weltkrieg als „Kaliningrader
Gebiet“ zur Sowjetunion gekommen und nach
deren Zerfall heute eine russische Exklave zwischen
Litauen und Polen. Wenige Kilometer hinter Tilsit
(heute: Sowjetsk) verliert die Memel (russisch:
Neman, litauisch: Namunas) ihren Namen: Die Hauptarme
ihres Deltas heißen nun Ruß und Gilge.
Volker Koepp beschreibt in Die Gilge eine einzigartige
Flusslandschaft, von der kaum jemand noch etwas
weiß. Ein kompliziertes Entwässerungssystem
machte die Gegend gleichzeitig zur landwirtschaftlichen
Besonderheit. Nach 1945 wurde hier die deutsche
Bevölkerung ausgesiedelt und es kamen Menschen
verschiedenster Nationalitäten aus vielen
Gebieten der früheren Sowjetunion. Der allgemeine
Verfall in Russland wirkt sich in dieser Exklave
besonders aus. Doch die Menschen geben nicht auf.
Unter ihnen: Sina, die rothaarige Melkerin. Sie
erzählt von ihrem Leben an der Gilge. Sina
lebt allein mit ihrer Tochter. Die Nachbarn sind
unfreundlich in ihrem Dorf.
Oder Anatoli. Vor Jahren aus Sibirien gekommen,
versucht er hinter dem Deich Landwirtschaft zu
betreiben, baut sich gar auf alten Grundmauern
ein neues Haus. Die Ufer der Gilge sind ein Paradies
für Meister Adebar, auf Anatolis Grundstück
mit der Kirchenruine kann man an die hundert Störche
zählen.
am 29.11.2005 um 20.00 Uhr
Herr Zwilling und Frau
Zuckermann
D 1999, R: Volker Koepp, 126’
Wo ist der Schnee von gestern, fragt Frau Zuckermann,
sie zitiert den Satz im französischen Original,
eine Verszeile von François Villon. Sie
ist eine weise, eine belesene alte Frau, sie lebt
in der Dichtung. Jeden Tag bekommt sie Besuch
von Herrn Zwilling, und dieses tägliche Zusammensein
bedeutet ein wesentliches Stück Erinnerungsarbeit
für die alte Stadt Czernowitz. Herr Zwilling
und Frau Zuckermann gehören zu den Überlebenden
der Stadt und der Kultur, für die sie einst
stand – der jüdischen Tradition des
einstigen Buchenlandes, der untergegangenen Bukowina.
Dann kamen die Tage, da wurden die jüdischen
Bewohner brutal deportiert, in die Gettos und
die KZs gesteckt. Und nach dem Krieg ist das Land
geteilt, im Wesentlichen an die Ukraine gekommen.
„>Sagen Sie’s jetzt<, hört
man immer wieder Koepps Stimme aus dem Off. Selten
hat das Kino sich so wunderbar selber reflektiert,
diskret, aber nachdrücklich. Die Kamera,
die so oft auf Aktion aus schien – hier
erweist sie sich als Instrument der Kontemplation,
um die Zeit selbst zu filmen.“ (Fritz Göttler)
am 30.11.2005 um 20.00 Uhr
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum
östliches Europa
DEZEMBER
CINEFEST: MEHRSPRACHENVERSIONEN
Der Kongress tanzt
englische Version: Congress Dances
D 1931, R: Erik Charell, D: Lilian Harvey, Willy Fritsch, Otto Wallburg, Conrad Veidt, 93' dt. OF
D 1931, R: Erik Charell, D: Lilian Harvey, Henry Garat, Gibb McLaughlin, Conrad Veidt, 93' engl. OF
1814. Als einer der letzten Herrscher, die sich zum Wiener Kongress versammeln, trifft Zar Alexander von Russland an der Donau ein. Die Handschuhverkäuferin Christel will Werbung für ihr Geschäft machen und wirft ein Bukett in seine Kutsche. Dies wird missverstanden und Christel als Attentäterin verhaftet.
"Als musikalische Verwechslungskomödie inszenierte Erik Charell den Traum der Handschuhverkäuferin, in einem Wien, das sich vor Wein- und Walzerseligkeit nicht zu lassen weiß. >Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein<, heißt das musikalische Leitmotiv im Film, aber es ist keine Warnung, sondern die Aufforderung zum größtmöglichen Genuss des Augenblicks." (Daniela Sannwald)
Die Ufa stellte unter Charells Regie noch eine französische ( Le congrès s'amuse ) und eine englische ( Congress Dances ) Version her. In allen drei Fassungen spielte Lilian Harvey die Rolle der Handschuhverkäuferin, ihr Traumpartner Willy Fritsch wurde in der englischen und französischen Fassung durch Henri Garat ersetzt.
am 01.12.2005 um 19.00 Uhr englische Version
am 01.12.2005 um 21.00 Uhr und am 03.12.2005 um 19.00 Uhr deutsche Version
WIEDERENTDECKT
Grock
D 1931, R: Carl Boese, D: Grock, Liane Haid, Betty Bird, Max von Embden, Harry Hardt, 92'
"Grock, der Clown, der sich von der Bühne zurückgezogen hat, gibt seine Abschiedsvorstellung. Die ganze Welt ist Parkett, solange das Negativ dieses Tonfilms existiert und Tonkopien durch die Apparate rasseln. Grock hat sich selbst ein Denkmal gesetzt. Nach Jahren werden die Menschen, die diesen Film sehen, noch sagen: Dieser Grock war ein großer Clown, ein begnadeter Künstler, ein Genie in seinem Beruf. Dieser Film wird eindringlicher von Grocks Ruhm erzählen als jede gedruckte Schilderung." So der Film-Kurier 1931 in seiner Uraufführungs-Kritik.
Carl Boese hat diesen "Tonfilm aus dem Leben eines weltberühmten Artisten" inszeniert. Im Mittelpunkt steht der weltberühmte Schweizer Clown Grock (Adrien Wettach, 1880-1954). Der erste Teil des Films bringt eine belanglose Handlung um und mit Grock, der sich nach seiner Abschiedsgala nur noch für die Gartenarbeit interessiert und damit seine mondäne Frau (Liane Haid) zutiefst langweilt. Es kommt zum Zerwürfnis, zur Trennung - und zum zweiten Teil des Films, der die erfolgreichsten Auftritte und klassischen Nummern Grocks als Tonfilmreportage festhält. "Er singt und tanzt und jongliert und schneidet Grimassen - es ist herrlich!" ( Film-Kurier ) Diese dokumentarische Inszenierung, ergänzt durch einige nur im Tonfilm möglichen Tricks, ist der eigentliche Gewinn dieses Films. "Denn dieser große Varietéakt veraltet nie, wird noch nach hundert Jahren sicher wieder erfreuen, und das allein schon macht diesen Film liebens- und lobenswert." ( Der Kinematograph ) Der in fünf Sprachversionen gedrehte Film war lange Zeit nur in der französischen Fassung bekannt. Wir zeigen erstmalig die deutsche Originalversion.
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Cinegraph Babelsberg und dem Bundesarchiv-Filmarchiv.
Einführung: Jeanpaul Goergen
am 02.12.2005 um 19.00 Uhr
MEHRSPRACHENVERSIONEN
April, April!
D 1935, R: Detlef Sierck, D: Carola Höhn, Albrecht Schoenhals, Erhard Siedel, Lina Carstens, Werner Finck, 82'
Dem reichen Nudelfabrikanten Julius Lampe ist sein Erfolg zu Kopf gestiegen: Man hält sich für was Besseres. Zu allem Überfluss kündigt sich auch noch ein Prinz an, der Lampes Nudelerzeugnisse auf eine Afrikaexpedition mitnehmen will. Freund Finke ärgert sich schon lange über des Fabrikanten Angeberei und will ihm einen Denkzettel verpassen - es ist der 1. April! Er lässt den Prinzen offiziell ankündigen, und das ganze Haus Lampe steht Kopf. Selbst die Zeitung annonciert den hohen Besuch. Doch Finkes Nerven sind zu schwach für den ganzen Trubel, er gesteht seinen Aprilscherz ein. Um das Ansehen des Hauses zu retten, wird nun der Geschäftsreisende Müller überredet, als Prinz aufzutreten.
"Satirisch akzentuiertes, turbulentes Verwechslungsspiel, dessen Albernheiten durch Seitenhiebe auf karrieresüchtige Kleinbürger ihre Würze erhalten." (Lexikon des internationalen Films)
Detlef Siercks Spielfilmdebut ist zugleich auch in einer niederländischen Version entstanden.
am 02.12.2005 und am
03.12.2005 jeweils um 21.00 Uhr
Flüchtlinge
D 1933, R: Gustav Ucicky, D: Hans Albers, Käthe von Nagy, Eugen Klöpfer, Ida Wüst, 88'
Text siehe 27.11.200505
am 04.12.2005 um 19.00 Uhr
Der blaue Engel
D 1930, R: Josef von Sternberg, D: Emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Rosa Valetti, 107'
Text siehe 17.11.200505
am 04.12.2005 um 21.00 Uhr
Die Privatsekretärin
D 1930, R: Wilhelm Thiele, D: Renate Müller, Hermann Thimig, Felix Bressart, Ludwig Stössel, 37' Fragment
Sunshine Susie
englische Version von Wilhelm Thieles Die Privatsekretärin
GB 1931, R: Victor Saville, D: Renate Müller, Owen Narres, Jack Hulbert, Sybil Grove, 80'
Text siehe 27.11.200505
am 08.12.2005 um 19.00 Uhr
Amphitryon - Aus den Wolken kommt das Glück
D 1935, R: Reinhold Schünzel, D: Willy Fritsch, Käthe Gold, Paul Kemp, Fita Benkhoff, Adele Sandrock, 105' dt. OF
Reinhold Schünzel verfilmte Heinrich von Kleists Drama als respektlose Verwechslungskomödie: Göttervater Jupiter (Willy Fritsch) erscheint in Theben, um Alkmene (Käthe Gold) zu verführen, deren Mann Amphitryon sich gerade auf Kriegszug befindet. Doch Alkmene ist treu, anders als ihre Dienerin Andria (Fita Benkhoff), die einem Techtelmechtel mit dem Gott Merkur (Paul Kemp) nicht abgeneigt ist. Getarnt als Ehemann Amphitryon kehrt Jupiter erneut bei Alkmene ein, entschlummert jedoch infolge Trunkenheit und verpasst beinahe die Ankunft des echten Amphitryon. Der glaubt, seine Frau habe ihn betrogen. Schließlich ruft die Göttergattin Juno (Adele Sandrock) ihren Gemahl heim und kann so die Situation retten.
"Die Götter sind recht menschlich und voller Schwächen, die Menschen gar nicht zum Höheren gedrängt. (.) Nichts ist in diesem Film auf das Erhabene, alles auf die Parodie aus - und sogar Masseninszenierungen nimmt er auf die Schippe." (Rainer Rother)
am 08.12.2005 um 21.15 Uhr
am 09.12.2005 um 19.00 Uhr
Les dieux s'amusent
französische Version von Amphitryon
D 1935, R: Reinhold Schünzel, D: Henri Garat, Jeanne Boitel, Armand Bernard, Marguerite Moreno, 105' franz. OF
Reinhold Schünzel drehte mit der Ufa 1935 parallel noch eine französischsprachige Version seines Films Amphitryon , um ihn einfacher im Ausland einsetzen zu können. Hier spielte Henri Garat die Doppelrolle des Göttervaters Jupiter und des strahlend jungen Amphitryons. Der Stoff hatte es schwer, manch einem galt der Film als Gotteslästerung. (Filminhalt siehe Text zu Amphitryon - Aus den Wolken kommt das Glück) "War Amphitryon im Inland zwar ein Erfolg, wenn auch nicht das erhoffte durchschlagende Geschäft, so hatte er es im Ausland zum Teil noch schwerer. Gegen den Film wurde in den USA von Emigranten-Organisationen eine Boykott-Kampagne gestartet, von der ab Oktober 1936 nach Babelsberg berichtet wurde. Der Boykott traf die französische Version Les dieux s'amusent , die in Kinos, die sich in New York auf fremdsprachige Filme spezialisiert hatten, boykottiert wurde." (Rainer Rother)
am 09.12.2005 um 21.00 Uhr
Anna Christie ( deutsche Version)
USA 1930, R: Jacques Feyder, D: Greta Garbo, Theo Shall, Hans Junkermann, Salka Steuermann, Hermann Bing, 93' dt. OF
In der amerikanischen Originalfassung (Regie: Clarence Brown) der Eugene-O'Neill-Verfilmung von "Anna Christie" spielten Charles Bickford, Georg F. Marion und Marie Dressler neben Greta Garbo. Es war Garbos erste Tonfilmrolle, die sie erst in englisch und kurz danach für die deutsche Version von Jacques Feyder in deutsch spielte. Sie selbst soll die deutsche Fassung bevorzugt haben, "weil ihr Makeup, ihre Kostüme und die Ausstattung realistischer waren." (Lottie Da und Jan Alexander: Bad Girls of the Silver Screen, New York 1989)
Anna Christie, Prostituierte in New York, kehrt, angeekelt, gebrochen und krank, zu ihrem Vater zurück, der ein Fischer ist. Bei einem Sturm retten sie den jungen Seemann Matt, der Anna Christie zu lieben beginnt. Als er von ihrer Vergangenheit erfährt, kommt es zum Eklat.
Der belgische Regisseur Jacques Feyder lebte seit 1929 in Hollywood und musste sich mit der Regie von deutschen und französischen Versionen von US-Kinoerfolgen begnügen, bevor er, 1933 heimgekehrt, seinen Ruf begründete, ein "Meister der französischen Schule des poetischen Realismus" zu sein. (Die Chronik des Films)
am 10.12.2005 um 19.00 Uhr
am 11.12.2005 um 21.00 Uhr
Cape Forlorn
englische Version von Menschen im Käfig
GB 1930, R: Ewald André Dupont, D: Fay Compton, Frank Harvey, Ian Hunter, Edmund Willard, 85' engl. OF
Mit dem an das Titanic-Unglück angelehnten Drama Atlantic (1929), das Ewald A. Dupont in drei verschiedensprachigen Fassungen herstellte, entstand sein erster Tonfilm, der in Deutschland erfolgreichste Kinofilm der Spielzeit 1929/30. Dupont, zu der Zeit in London lebend, inszenierte weiter britische Filme und deren deutsche Versionen, ehe er 1931 nach Berlin zurückkehrte. Während seiner Londoner Jahre entstand auch das Leuchtturm-Drama Cape Forlorn/ Menschen im Käfig , das in einer deutschen, englischen und einer französischen Sprachversion ( Le cap perdu ) gedreht wurde.
Cape Forlorn , nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Frank Harvey gedreht, ist ein außergewöhnlich fotografiertes Melodram um eine Tänzerin, die auf einen Leuchtturmwärter trifft und ihn heiratet. Sie beginnt aber schnell, das Leben mit ihm zu hassen und lässt sich auf eine stürmische Affäre mit dem Assistenten ihres Mannes ein. Eines Tages wird ein attraktiver Schiffbrüchiger an Land gespült, und die Tänzerin verliebt sich in ihn. Das sorgt für neue Aufregung im Leuchtturm und gipfelt am Ende in einem Mord.
am 10.12.2005 um 21.00 Uhr
am 11.12.2005 um 19.00 Uhr
40 JAHRE 11.2005PLENUM DES ZK DER SED:
REGALFILME DER DEFA
Das Kaninchen bin ich
DDR 1966, R: Kurt Maetzig, D: Angelika Waller, Alfred Müller, Ilse Voigt, 118' Marias Bruder sitzt wegen angeblicher "staatsgefährdender Hetze" im Zuchthaus. Als Maria sich in Paul verliebt erfährt sie, dass er Richter im Prozess ihres Bruders war. Maetzigs Film wurde am Tag vor dem offiziellen Beginn des Plenums in einer geschlossenen Sondervorführung gezeigt. Er sollte als "abschreckendes Beispiel" präsentiert werden - in den folgenden Tagen nahmen die Kader immer wieder auf ihn Bezug. Brisant genug war sein Thema: die durchaus nicht freie, sondern von den Vorgaben der Partei gegängelte Justiz.
Eröffnung Helmut Morsbach (DEFA Stiftung),Gerhard Sieber (ICESTORM) und Dr. Rainer Rother (Zeughauskino DHM)
Nach dem Film Gespräch mit Prof. Kurt Maetzig, Prof. Dr. Günter Witt, Angelika Waller
Moderation: Paul Werner Wagner
am 15.12.2005 um 18.45 Uhr
Der verlorene Engel
DDR 1966/71, R: Ralf Kirsten, D: Fred Düren, Erika Pelikowsky, Erik S. Klein, 60'
Der Film nach der Novelle "Das schlimme Jahr" von Franz Fühmann reflektiert einen Tag im Leben des Künstlers Ernst Barlach, den 24. August 1937. Anlass zur Selbstreflexion gab der Diebstahl des "Schwebenden Engels" aus dem Dom zu Güstrow. Barlach lebte zu dieser Zeit bereits völlig isoliert.
am 15.12.2005 um 22.00 Uhr
Wenn du groß bist, lieber Adam
DDR 1965, R: Egon Günther, D: Manfred Krug, Gerry Wolff, Stephan Jahnke, 72'
Der kleine Adam hat eine Taschenlampe, deren Strahl Lügner in die Luft steigen lässt. Mit dem Vater will er sie in Serie herstellen, doch niemand will so eine Lampe haben. Die Gefahr ist zu groß, dass schließlich alle Erwachsenen durch die Lüfte schweben. Das poetische Filmmärchen konnte 1990 rekonstruiert werden. Die gegenüber der ursprünglichen Fassung fehlenden Szenen werden durch Einblendungen der entsprechenden Drehbuchpassagen ergänzt. Ironisch und frech.
Anschließend Gespräch mit Egon Günther, Helga Schütz, Hans Bentzien
Moderation: Paul Werner Wagner
am 16.12.2005 um 19.00 Uhr
Denk bloß nicht, ich heule
DDR 1965, R: Frank Vogel, D: Peter Reusse, Jutta Hoffmann, Arno Wyzniewski, 94'
Peter liebt den Sozialismus nicht. Er will weder lügen noch heulen und bekennt in einem Aufsatz: Die Republik braucht mich nicht, ich brauche die Republik nicht.
Im Haus des ZK, ansonsten nicht für Filmvorführungen genutzt, erlebte der Film eine Sonderpräsentation für die Sitzungsteilnehmer. Er fand, erwartungsgemäß, keine Fürsprecher, die Absicht der SED-Führung war eindeutig und ging auf.
am 16.12.2005 um 22.00 Uhr
CHARLIE CHAPLIN
The Kid
USA 1921, R: Charlie Chaplin, D: Charlie Chaplin, Edna Purviance, Jackie Coogan, Carl Miller, ca. 68'
Ein Tramp (Charlie Chaplin) findet einen ausgesetzten Säugling, den er vergeblich loszuwerden versucht. Fünf Jahre später sind die beiden ein Herz und eine Seele geworden, der Junge (Jackie Coogan) hat bis in die kleinsten Gesten die Gewohnheiten des Ziehvaters angenommen. Einer steht für den anderen ein. Doch das Glück scheint nicht von Dauer, da die Mutter (Edna Purviance), inzwischen zu einer berühmten Schauspielerin geworden, das Kind zurückholt. Charlie versucht sich mit einem Traum zu trösten, doch die Realität ist noch schöner als alle Träume: Die Mutter des Jungen hält in einem eleganten Wagen vor der Tür, um Charlie zu holen. Schließlich gehört zu einer glücklichen Familie auch ein Vater.
The Kid ist Chaplins erster Langfilm, der bei seiner Uraufführung in New York begeistert aufgenommen wurde. Der erst sechsjährige Jackie Coogan startete mit dem Film eine Karriere als Kinderstar. Doch seine wohl berühmteste Rolle hatte Coogan nach jahrelangen Schwierigkeiten als Uncle Fester in der Fernsehserie "The Addams Family". Aus dem wundervollsten Kind der Welt war der abscheulichste aller alten Männer geworden.
Klavierbegleitung: Peter Gotthardt
am 17.12.2005 um 15.00 Uhr
am 18.12.2005 um 21.00 Uhr
His Musical Career
USA 1914, R: Charles Chaplin, D: Charles Chaplin, Mack Swain, Fritz Schade, Alice Howell, 18'
35 kurze Filme machte Chaplin 1914 für Mack Sennetts Keystone Comedy Company. In His Musical Career betätigen sich Charlie und Mack als Spediteure. Sie sollen Mr. Rich ein neues Piano bringen und bei einem säumigen Zahler ein anderes abholen. Leider verwechselt Charlie die Adressen der Kunden.
"Zum Kreischen!" (Bioscope)
A Dog's Life
Ein Hundeleben
USA 1918, R: Charlie Chaplin, D: Charlie Chaplin, Edna Purviance, Tom Wilson, Henry Bergman, ca. 40'
Am 17. April 1919 gründeten vier der bekanntesten Persönlichkeiten des US-amerikanischen Films, die Schauspieler Charles Chaplin, Douglas Fairbanks und Mary Pickford sowie der Regisseur David Griffith, die United Artists Corporation als eigene Produktions- und Verleihgesellschaft. Das Unternehmen verfolgte das Ziel, Qualitätsfilme unabhängiger Filmemacher zu finanzieren und für deren Verleih zu sorgen. In erster Linie aber wollten sich die Mitglieder auch die Kontrolle über ihre eigenen Profite sichern.
Zu dieser Zeit entwickelte Charles Chaplin als Filmfigur den Typus des Tramps mit dem Watschelgang und dem heruntergekommenen dandyhaften Outfit. Schon in seinen ersten, kürzeren, Filmen spielte er stets die Rolle des sozial Deklassierten, der sich mit List und Tücke gegen die Schönen und Erfolgreichen behauptet.
In A Dog's Life übernimmt Charlie die Verhaltensweisen seines Hundes und Gefährten Scrap und gelangt so unverhofft zu Glück und Geld. Viele Intellektuelle der damaligen Zeit entdeckten in dem Film eine Anklage gegen das kapitalistische System.
Klavierbegleitung: Peter Gotthardt
am 17.12.2005 um 19.00 Uhr
am 18.12.2005 um 15.00 Uhr
The Circus
USA 1928, R: Charlie Chaplin, D: Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Allen Garcia, Henry Bergman, 71'
Henry Bergman, der viele Jahre zusammen mit Chaplin gearbeitet hat und in The Circus einen Clown spielt, beschreibt die Entstehung der Filmidee so: "Bevor er (Charlie Chaplin) mit The Circus angefangen hat, hat er eines abends zu mir gesagt: Henry, ich würde gern mal einen Gag bringen, bei dem ich in eine Lage gerate, aus der ich mich aus irgendeinem Grund nicht befreien kann. Ich hänge irgendwo hoch oben in der Luft und werde von irgendwas geplagt, Affen oder so was, die mich bedrängen und die ich nicht loswerden kann." (aus David Robinson: Chaplin. Sein Leben. Seine Kunst) Danach zog sich Chaplin mit seinem neuen Assistenten Harry Crocker, der später die Rolle des Rex bekam, für zehn Tage nach Del Monte zurück, um an der Story zu arbeiten, während sich die Studiobelegschaft daran machte, auf dem Studiogelände ein Zirkuszelt und eine Menagerie aufzubauen. Nachdem die beiden zurückkamen, erfüllte Bergman sein Versprechen und brachte Chaplin Seiltanzen bei: "Ich hab Charlie innerhalb einer Woche das Seiltanzen beigebracht. Wir haben das Seil so hoch über dem Boden gespannt (er deutete dem Interviewer eine Höhe von 30 Zentimetern an), dann haben wir es bis unter die Decke erhöht, mit einem Netz darunter, aber Charlie ist nie gefallen." (aus David Robinson: Chaplin. Sein Leben. Seine Kunst)
Klavierbegleitung: Peter Gotthardt
am 17.12.2005 um 21.00 Uhr
am 18.12.2005 um 19.00 Uhr
40 JAHRE 11.2005 PLENUM DES ZK DER SED:
REGALFILME DER DEFA
Karla
DDR 1965/66, R: Hermann Zschoche, D: Jutta Hoffmann, Rolf Hoppe, Jürgen Hentsch, Inge Keller, Dieter Wien, 129'
Die junge Lehrerin Karla will ihre Schüler zu selbständigem Denken führen. Doch die wissen längst, was man ohne Nachteil sagen kann und wann man besser schweigt . Der Konflikt mit dem Direktor, dogmatisch an der offiziellen Lehre festhaltend, kann kaum gut ausgehen. "Die Zensoren bestätigen, dass der Film zwar gut gemeint sei, aber objektiv schade." (Lexikon des internationalen Films)
Anschließend Gespräch mit Jutta Hoffmann, Herrmann Zschoche, Wolfgang Kohlhaase, Prof. Dr. Frank Hörnigk, Moderation: Paul Werner Wagner
am 19.12.2005 um 19.00 Uhr
Berlin um die Ecke
DDR 1965, R: Gerhard Klein, D: Dieter Mann, Monika Gabriel, Erwin Geschonneck, Kaspar Eichel, 73'
Die Wünsche und Träume der Jugendlichen, ihr Aufbegehren gegen Autoritäten waren ein wiederkehrendes Thema der 1965/66 verbotenen DEFA-Filme. Obwohl sie nie von unüberwindbaren Schwierigkeiten ausgingen, vielmehr die Konflikte so anlegten, dass eine Lösung immerhin möglich schien, waren sie aus Sicht der SED gänzlich inakzeptabel. So auch die Geschichte von Olaf und Horst. Diese arbeiten in einem Metallbetrieb mitten in Berlin. Sie wollen weg vom genormten Alltag. Da kommt ihnen eine verrückte Idee.
am 19.12.2005 um 21.00 Uhr
Jahrgang 45
DDR 1965/66, R: Klaus Poche, D: Rolf Römer, Monika Hildebrand, Paul Eichbaum, Renate Reinecke, 94'
Al und Li empfinden ihre Ehe als Zwang. Sie kosten die spielerische Freiheit des Daseins aus, doch ihre Umgebung begreift das als Flucht vor der Verantwortung.
Ein ungewöhnlich "frischer" Film, die Darsteller sind sehr überzeugend in ihrer Verunsicherung, die mit salopper Pose überspielt wird. Zudem sind die Drehorte glänzend gewählt, geben ein ungeschminktes Bild des damaligen Ostberlin.
Anschließend Gespräch mit Jürgen Böttcher, Roland Gräf, Klaus Poche
Moderation: Paul Werner Wagner
am 20.12.2005 um 19.00 Uhr
Der Frühling braucht Zeit
DDR 1965,, R: Günther Stahnke, D: Hermann O. Lauterbach, Konrad Schwalbe, Günther Stahnke, Darsteller: Eberhard Mellies, Elfriede Née, Doris Abeßer, Günther Simon, 76'
Mitten im Winter - Havarie an der Ferngasleitung. Wer trägt die Schuld, der eitle Werkdirektor, der angepasste Ingenieur, der ehrgeizige Politiker oder der zuständige Praktiker? Auch hier geht es um den Konflikt zwischen den Parteileuten und denen, die unter ihren Vorgaben leiden. Stahnkes Film war bereits kurz vor dem Plenum in der DDR angelaufen, doch wurde er unmittelbar danach verboten.
am 20.12.2005 um 21.15 Uhr
Spur der Steine
DDR 1966, R: Frank Beyer, D: Manfred Krug, Eberhard Esche, Krystyna Stypulkowska, 150'
Baubrigadier Balla und seine Leute wollen nicht länger die Rechnung für die Fehler des Managements zahlen. Mit anarchistischen Methoden verschaffen sie sich den nötigen Respekt. Der populärste aller "Regalfilme", nicht zuletzt wegen Manfred Krugs Verkörperung des aufmüpfigen Balla. Ungewöhnlich auch die Schauwerte des Cinematoscope-Formats, das die Brigadiere manchmal durchschreiten wie Westernhelden.
Anschließend Gespräch mit Frank Beyer, Manfred Krug (angefragt), Helmut Morsbach
Moderation: Paul Werner Wagner
am 21.12.2005 um 19.00 Uhr
Fräulein Schmetterling
DDR 1965/66,, R: Kurt Bartel, D: Melania Jakubisková, Christa Heiser, Herwart Grosse, Rolf Hoppe, Lissy Tempelhof, 118'
Nach dem Tod ihres Vaters greift der Staat unsanft in das Leben der zwei Waisen Helene und Asta ein. Helene flüchtet sich in ihre Traumwelten.
Im Unterschied zu anderen Filmen des im Rückblick einzigartigen DEFA-Jahrgangs war "Fräulein Schmetterling" zum Zeitpunkt des berüchtigten Plenums des ZK der SED im Dezember 1965 zwar abgedreht, aber noch mitten in der Nachproduktion. Daher existiert ein vollständiges Bildnegativ, bei einigen Aufnahmen sogar Varianten, jedoch kein Rohschnitt mehr. Der Ton ist nicht vollständig überliefert, die dokumentarischen Sequenzen waren unmontiert. Dem Verständnis des Torsos ist das nicht hinderlich. Wo Dialog fehlt, oder die slowakische Darstellerin nicht synchronisiert ist, helfen Untertitel. So war eine Rekonstruktion nicht möglich - aber die Dokumentation des Vorhandenen ist aufschlussreich genug.
am 21.12.2005 um 22.00 Uhr
|