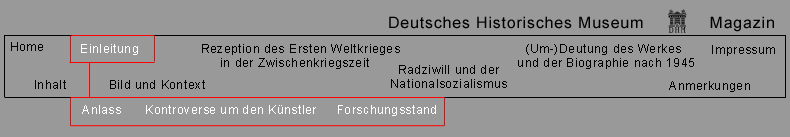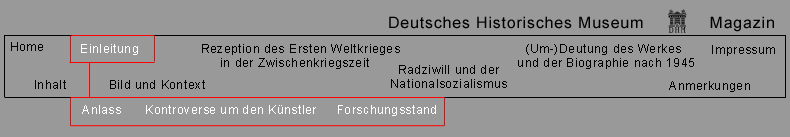Die Kunstgeschichte war sich von 1945 bis heute weitgehend einig in dem
Urteil, der Künstler habe in seinen Kriegsbildern die "apokalyptische
Trostlosigkeit" zeigen wollen. Repräsentativ für die Phase nach dem
Zweiten Weltkrieg ist die Einschätzung des Kunsthistorikers und Freundes von Radziwill,
Wilhelm Niemeyers, der 1955 im "Grab im Niemandsland" eine erschütternde
Anklage gegen den Krieg und ein "weltgroße(s) Sinnbild unseres (des deutschen,
K. A.) Schicksals" sah.3 Weniger pathetisch, aber in der Deutung ähnlich
ist die Mitte der neunziger Jahre geäußerte Ansicht des Berliner Kunsthistorikers
Roland März. Radziwill habe "leidenschaftslos ›Passionsbilder der Erde‹
und Denkmäler des Krieges ohne Tendenz"4 gemalt. Diese Urteile geben die
gegenwärtig vorherrschende Ansicht wieder.
Es gibt einige Lücken in der Forschung zu den Kriegsbildern und der Biographie des
Künstlers. So wird nicht ausführlicher auf den Umstand eingegangen, daß Radziwill das
"Grab im Niemandsland" erst 1934 malte, also fünf Jahre nachdem er zum erstenmal in den
Gemälden "Der Unterstand am Naroczsee" (1929) und "Das Schlachtfeld von Cambrai, 1917" (1930)
die Kriegsthematik aufgriff. Sein Interesse für das Thema fiel genau in die Zeit der
Weltwirtschaftskrise von 1929, seiner zunehmenden Distanzierung von sozialistisch
eingestellten Freunden und Kollegen und seiner Hinwendung zu national-konservativen
Kreisen und der Kriegsmarine in Wilhelmshaven. Bis vor kurzem hatten auch Radziwills
republikfeindliche Haltung und seine Abwendung von der ungefestigten Demokratie im Jahre
1923 wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Situation und seine Hoffnung auf einen
erfolgreichen Putsch von rechts wenig Beachtung gefunden.8 "Mit der größten Freude
würde ich es begrüßen, wenn wir zu einer Diktatur kommen würden, denn im Augenblick
erscheint Deutschland mir wie ein großes Loch, aus dem man einen schon stark verwesten
Leichnam genommen hat, um diesen nochmal zu sezieren, um ihn dann voll der Erde zu
übergeben mit einem abgeschlossenen Urteil."9 Seine Sympathie für den rechtsextremen
politischen Rand in dieser Periode mag auch familiäre Gründe gehabt haben. Einer seiner
Brüder diente in einem paramilitärischen Freikorps und kam bei einem Attentat auf seinen
Vorgesetzten in Düsseldorf als dessen Fahrer ums Leben.10 Aber auch des Künstlers
romantische Hinwendung zum Landleben durch seinen Umzug nach Dangast, einem Fischerdorf
und Badeort in der Nähe Wilhelmshavens an der Nordseeküste, wo schon die Künstler der
Gruppe Die Brücke gemalt hatten, wurde in der Literatur kaum untersucht. Radziwill
vollzog mit dieser Flucht aus der Stadt einen Schritt nach, den vor ihm schon die anderen
Künstlergemeinschaften im ausgehenden 19. Jahrhundert gemacht hatten. Mit den norddeutschen
Worpsweder Künstlern war Radziwill persönlich bekannt. Sie hatte er vor dem Krieg
kennengelernt. Deren Suche nach dem "nordischen", "mystisch-mythischen" Licht dürfte
ihm vertraut gewesen sein. Auch für ihn hatte das Licht der Nordseeküste eine besondere
Bedeutung. In der Entscheidung, das Land der Stadt vorzuziehen, spiegelt sich ohne
Zweifel Radziwills zivilisationskritische Haltung wider, die er in den zwanziger Jahren
einnahm. Sie war gekennzeichnet von der Betonung des "Heimatlichen" und fand in den
Sujets seiner Malerei (Stilleben, Landschaft) und der Hinwendung zur altmeisterlichen
Technik ab Mitte der zwanziger Jahre ihren sichtbaren Niederschlag.