
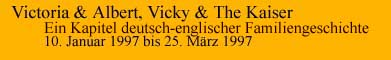

|
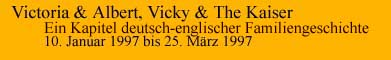
|
||
| Das unprovokative Erscheinungsbild des Königs und seiner Gemahlin, Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, und die reduzierte Machtfülle der Monarchie trugen dazu bei, daß der Funken der Französischen Revolution nicht auf das durch die frühe Industrialisierung prosperierende Großbritannien übersprang. In eben jener Zeit, als die bürgerliche Welt sich anschickte, ihre moralischen Standards als universal gültige durchzusetzen, mußte ein Lebensstil, der Elemente barocker Maßlosigkeit aufwies, auf Befremden stoßen. Von Spielleidenschaft, Verschwendungssucht, chronischer Zahlungsunfähigkeit, skandalträchtigen Affären, illegitimen Kindern bis hin zu Arroganz und Desinteresse an politischen Aufgaben reichte das königliche Sündenregister. Als Georg IV. 1830 starb, schrieb die konservative Times: "Nie ist eine Person von den Mitmenschen weniger betrauert worden als der verstorbene König. ... Sollte Georg IV. jemals einen Freund, einen wirklichen Freund, in irgendeiner Volksschicht gehabt haben, so dürfen wir behaupten, daß dessen oder deren Namen uns niemals zu Ohren gekommen ist." Und sieben Jahre später, beim Tode seines Nachfolgers, hieß es im liberalen Spectator: "Trotz seiner Willensschwäche, seiner Beschränktheit, seiner mangelnden Bildung und seines Starrsinns war Wilhelm IV. bis zuletzt ein volkstümlicher Herrscher. Doch war dies eine Popularität, die auf einer Art öffentlicher Verachtung, keineswegs aber auf Respekt gegenüber dem Herrscher beruhte." |