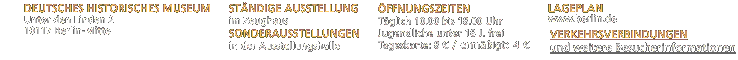KUNST DES DOKUMENTS - FAMILIENGESCHICHTEN
Geschichte als Verdrängung, Heimsuchung, offene Wunde und unüberbrückbarer Spalt. Die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus und Holocaust ist seit geraumer Zeit im dokumentarischen Kino ein Ringen um Wahrheit und Ehrlichkeit, in das Familien, Freundeskreise und Schulklassen involviert sein können. Filme erzählen von einem Leben, das mit einem lebenslangen Schmerz, wenn nicht gar Trauma bezahlt worden ist und das Spuren auch noch in jenen hinterlässt, die während des „Dritten Reichs“ noch gar nicht geboren waren. Die Begegnungen der Tochter mit ihren Eltern, des Sohnes mit seinen Geschwistern, der Cousinen mit ihrer Tante – sie setzen Prozesse der Annäherung und Entfremdung in Gang, die – so hat es oft den Anschein – nicht zu einem Abschluss werden kommen können. KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN versammelt acht Dokumentarfilme aus den vergangenen beiden Jahrzehnten, die diesen Erfahrungen Bilder und Töne geben
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
Kinderland ist abgebrannt
D 1998, R/B: Sibylle Tiedemann, Ute Badura, 94’ 16 mm
Jüdische und nicht-jüdische Einzelschicksale der Jahrgänge 1934 bis 1942 in einer Ulmer Mädchenoberschule. 60 Jahre später kommen einige der damaligen Schülerinnen zum „Klassentreffen“ zusammen und erinnern sich an Kindheit und Jugend. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten gehen die Erlebnisse der acht christlichen und vier jüdischen Frauen immer stärker auseinander. Die einen treten begeistert in die Jungmädelgruppe ein; ihr Vorbild wird die BDM-Führerin Sophie Scholl, die auf dieselbe Schule geht und deren Entwicklung zum Widerstand der Weißen Rose sie nicht verstehen. Dann bestimmt der Kriegsalltag ihr Leben. Die anderen werden schrittweise entrechtet und ausgegrenzt, schließlich vom Unterricht ausgeschlossen. Sie dürfen sich nur noch in jüdischen Vereinen organisieren. Während ihre Großeltern deportiert werden, können sie sich in die Emigration retten. Amateurfilme und persönliche Dokumente ergänzen die Erinnerungen der Frauen, die unkommentiert wiedergegeben werden. „Sibylle Tiedemann und Ute Badura haben in ihrem Dokumentarfilm stille, schlichte Stimmen eingefangen, in denen das Dritte Reich unterschiedlich nachhallt. (...) Durch die einfache Dokumentation der authentischen Erzählungen stellen die Autorinnen die Frage nach Schuld und Unschuld am eindringlichsten.“ (taz, 5.11.1999).
am 3.6.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
Habehira Vehagoral
Choice and Destiny
IL 1993, R/B: Tsipi Reibenbach, 118’ 16 mm, OmU
„Die Protagonisten des Films sind das Ehepaar Yitshak und Fruma. Er ist 80, sie ist 72. Es sind meine Eltern. Sie sind Überlebende des Holocaust und leben heute in Israel. Mit dem Wunsch, sie zu verstehen, fuhr ich an die Orte, wo sie geboren wurden und wo ihnen während des Zweiten Weltkriegs die Freiheit versagt wurde. Sie wollten mich nicht begleiten. Auf der Reise nach Polen, Österreich und in die Tschechoslowakei stellte ich fest, daß dort nichts für mich zu finden war. Ich begriff: Wenn es eine Chance gibt, etwas zu verstehen oder zu fühlen, mußte ich die Menschen suchen, die noch unter uns sind. Mein Vater war bereit, mitzuarbeiten. Er erzählt, wie er die Vernichtung des Ghettos von Miechow überlebte und dann die Arbeits- und Todeslager Auschwitz-Birkenau und Mauthausen. Mutter wollte und konnte nicht darüber sprechen. Unter dem Einfluß der Kamera aber öffnete sie sich und sprach vom Hunger und der Erniedrigung im Arbeitslager, von ihrer Familie, die zu Hause geblieben war und nicht mehr existiert. Es ist ein Film über das Ende des Lebens, über das Älterwerden, über Menschen, die einer aussterbenden Generation angehören, mit der auch die speziell jüdischen Mahlzeiten und die Zeugnisse aus erster Hand aussterben.“ (Tsipi Reibenbach, Jüdische Filmtage 1999, Oldenburg).
am 10.6.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
Was bleibt
D 2008, R: Gesa Knolle, Birthe Templin, 58’ Beta SP
Die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte und dem Holocaust sowohl in einer Opfer- als auch einer Täterfamilie, die über das Konzentrationslager Ravensbrück miteinander verbunden sind. In Ravensbrück sieht die 17jährige Erna de Vries ihre Mutter zum letzten Mal. Sie verspricht ihr, von dem erlebten Grauen zu erzählen und tut das bis heute. Sowohl Tochter Ruth wie Enkelin Rebecca sehen es als Aufgabe ihrer jüdisch-deutschen Familie an, die Geschichte weiter zu tragen. Die Österreicherin Dietlinde erfährt erst durch Nachforschungen, dass ihre bereits 1945 gestorbene Mutter KZ-Aufseherin in Ravensbrück war. Seitdem versucht sie, sich ein Bild der ihr unbekannten Mutter zu machen. Ihre Tochter Eva reagiert mit Abgrenzung und Distanz auf diesen Teil der Familiengeschichte. – Was bleibt konzentriert sich auf die weiblichen Mitglieder der zwei Familien; erst die Interviewmontage führt ihre unterschiedlichen Geschichten zusammen. „Die Verzahnung von Vergangenheit und Gegenwart wird allein durch die Erzählungen deutlich. Bewusst haben die Filmemacherinnen sich gegen die Montage von Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Lagers oder Dokumentarmaterial entschieden. Die Klarheit, die daraus entsteht, wirkt wohltuend.“ (Ulrike Schneider, Jüdische Zeitung, Mai 2008).
In Anwesenheit von Gesa Knolle
am 17.6.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
A Letter Without Words
USA 1998, R/B: Lisa Lewenz, 64’ 16 mm, OmU
Dutzende 16mm-Farbfilme, von Ella Arnhold-Lewenz bis zu ihrer Emigration 1937 in Berlin aufgenommen, bilden die Grundlage dieser Suche nach einer jüdischen Identität. Ella Arnhold-Lewenz stirbt 1954 und ihre Aufnahmen geraten in Vergessenheit. 1981 entdeckt Lisa Lewenz die Amateurfilme ihrer Großmutter und damit auch einen bisher kaum bekannten Teil der Familiengeschichte. Die Filmaufnahmen dokumentieren das gesellschaftliche Leben einer großbürgerlichen deutsch-jüdischen Familie, aber auch die äußeren Zeichen des Nazi-Regimes wie marschierende SS-Truppen, Straßen voller Hakenkreuzfahnen und „Juden nicht erwünscht“-Schilder. „Es war, als hätte ich die Büchse der Pandora geöffnet“, sagt Lisa Lewenz zu diesen Filmen. Ihr Vater war bereits 1932 in die USA ausgewandert, hatte sich taufen lassen und eine evangelische Frau geheiratet. Mit den Filmen im Gepäck reist Lisa Lewenz nach Berlin, um die Aufnahmen der Großmutter durch Interviews mit Verwandten und Zeitzeugen sowie mit Bildern von heute zu ergänzen. Es wird eine Reise zu den Wurzeln ihrer Familie und ein sehr persönlicher Dialog mit ihrer Großmutter, die sie nicht mehr kennengelernt hat.
am 24.6.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß
D 2005, R/B: Malte Ludin, 89’ 35 mm
Am 9. Dezember 1947 wird der überzeugte Nationalsozialist und SA-Führer der ersten Stunde Hanns Ludin in Bratislava als Kriegsverbrecher gehängt. Adolf Hitler hatte ihn 1941 als Gesandten und Bevollmächtigten Minister in die Slowakei geschickt, wo er für die Deportation der dort lebenden Juden verantwortlich war. Sein jüngster Sohn Malte, geboren 1942, wagt sich an die Aufarbeitung der im Kreis der Familie verdrängten, aber dennoch omnipräsenten Rolle des Vaters im „Dritten Reich“. Der Regisseur konfrontiert drei Generationen der Familie mit den historischen Fakten: nicht als Außenstehender, sondern als gleichermaßen unmittelbar Betroffener. Es sind schmerzhafte, konfliktgeladene Prozesse für alle Beteiligten, zumal dort, wo es zu direkten Begegnungen mit früheren Opfern des Vaters, wie dem Schriftsteller Tuvia Rübner, kommt... – „Ich glaube, das Schweigen über eine wesentliche Zeit ihres Lebens ist bei vielen Eltern meiner Generation weit verbreitet. Diese biographischen und historischen Aussparungen haben immer noch Folgen und eine unkontrollierte, bis heute aktive Dynamik. Mit diesem Film habe ich zwar ein sehr persönliches Projekt verfolgt, aber die Geschichte geht weit über das bloß Private – also meine Familie – hinaus. Was ich erzähle, findet sich, vielleicht nicht so zugespitzt, in sehr vielen anderen, ganz normalen deutschen Familien auch.“ (Malte Ludin).
am 8.7.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
Kaddisch
CH 1997, R: Beatrice Michel, Hans Stürm, 90’ 35 mm
Die zentralen Figuren dieses Dokumentarfilms über die Erinnerungen einer jüdischen Familie an den Holocaust sind mit Schauspielern besetzt; die übrigen Mitwirkenden aber sind „reale“ Personen. Hannah (dargestellt von Serene Wey) wächst bei ihrer Großmutter in der Schweiz auf; die Eltern hat sie kaum gekannt. Ihr aus Ungarn stammender Vater (gespielt von Ferenc Bács) hat als Kind Auschwitz überlebt und sich in der Schweiz niedergelassen. Jetzt reist Hannah zu seiner Beerdigung. An seinem Grab spricht sie das Kaddisch, das jüdische Gebet, das von den Kindern für ihre verstorbenen Eltern gesprochen wird. Damit eröffnet sie die Schiwa, die siebentägige Trauerzeit der Familie – Zeit auch, um zusammenzusitzen und Geschichten auszutauschen. Denn die jüdische Familie nimmt die Schauspielerin wie eine reale Tochter auf... „‚Als Hannah durfte sie Fragen stellen, die man sonst Überlebenden des Holocaust nicht stellt. Diese Fiktion im Rahmen der realen Interviews gehöre zum Konzept, Dokumentarisches mit Poetischem zu verbinden’, sagt Beatrice Michel und räumt ein, dass dieses Vorgehen durchaus ‚gefährlich’ sei, da das Publikum Fiktion und Realität vermischen könnte.“ (Karin Müller, mybasel.ch).
am 15.7.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
Voices from the Attic
USA 1988, R: Debbie Goodstein, 60’ 16 mm, OmU
Zusammen mit fünf Cousinen und ihrer Tante reist die amerikanische Filmemacherin Debbie Goodstein nach Polen. Sie wollen sich jenen Dachboden ansehen, auf dem sich ihre Familie während des Krieges zwei Jahre lang verstecken konnte. Sie treffen die Bäuerin Maria Gorocholski wieder, die die Familie vor dem Zugriff der Nazis rettete – ein Überleben um den Preis eines lebenslangen Traumas, das sich auch auf jene auswirkt, die damals noch nicht geboren waren: „Solange ich mich erinnern kann, hatte ich Alpträume und erlebte Dinge, die vor meiner Geburt an einem Ort, den ich noch nie gesehen hatte, passiert waren. Ich wurde von Geschichten heimgesucht, die ich noch nie gehört hatte“. (Debbie Goodstein). Der Dachboden: 15 Quadratmeter, nur 1,63 m hoch, ohne fließendes Wasser, ohne Licht. 15 Menschen auf engstem Raum, und nicht alle überleben Hunger, Hitze, Kälte und Verzweiflung. Später, in Brooklyn, können und wollen sich die Geretteten nur mit vielen Auslassungen erinnern, und nur allmählich entschlüsselt Debbie Goodstein die Geschichte ihrer Familie.
am 22.7.2010 um 20.00 Uhr
KUNST DES DOKUMENTS – FAMILIENGESCHICHTEN
Will My Mother Go Back to Berlin?
USA 1992, R: Micha X. Peled, 53’ Beta SP, OmeU
Micha X. Peled lebt in San Francisco, seine in Berlin geborene Mutter Nora in Tel Aviv. Seit ihrer Emigration 1937 weigert sie sich, jemals wieder deutschen Boden zu betreten. Auf der Suche nach ihrer Geschichte reist Peled nach Berlin. Zusammen mit einer alten Freundin seiner Mutter überlegt er, wie er sie zu einer Reise in ihre alte Heimatstadt bewegen könnte. Mit einer offiziellen Einladung des Regierenden Bürgermeisters fährt er nach Israel. Die langen Gespräche zwischen Mutter und Sohn kreisen vor allem um die Familiengeschichte und ihre jeweiligen unerfüllten Sehnsüchte: die des unehelichen Sohnes nach einem Vater, die der Mutter nach Enkelkindern. Schließlich zeigt ihr Peled die Einladung und das Flugticket nach Berlin...
am 29.7.2010 um 20.00 Uhr
|