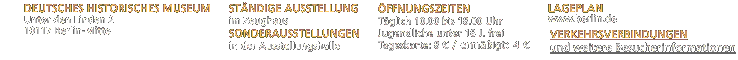KUNST DES DOKUMENTS – VÄTER UND SÖHNE
Von schwierigen, oft konflikt- und spannungsreichen Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen erzählt die Reihe KUNST DES DOKUMENTS im Anschluss an die Berlinale. Die ausgewählten Filme sind Teil einer Dokumentarfilmgeschichte, die ab den 1970er Jahren das Private erkundet und die auch den familiären Banden eine allgemeinere, gesellschaftliche Bedeutung zuschreibt. In einigen Filmen der Reihe KUNST DES DOKUMENTS – VÄTER UND SÖHNE greift der Sohn sogar selbst zur Kamera, um mit dem Vater wieder Kontakt aufzunehmen – in der Hoffnung, sich mit ihm verständigen zu können. Das Filmprojekt wird zu einem Mittel der Auseinandersetzung und Therapie, wo andere Wege nicht mehr zur Verfügung stehen.
Thomas Harlan – Wandersplitter
D 2006, R: Christoph Hübner, 96’ Beta SP
Thomas Harlan, geboren 1929, ist der älteste Sohn Veit Harlans, des Regisseurs von Jud Süß (1940) und Kolberg (1945). Gilt sein Vater als der große Propagandist der nationalsozialistischen Ideologie, so klärt Thomas Harlan seit den 1950er Jahren über die Verbrechen des „Dritten Reichs“ auf. Als Schriftsteller, Filmemacher, unermüdlicher Forscher und politischer Aktivist erhebt er seine Stimme gegen Unrecht und Unterdrückung. Thomas Harlan hat in Frankreich, Polen und Portugal gelebt; er hat Freundschaften mit vielen Intellektuellen geschlossen und ist als streitbare Persönlichkeit aus dem Schatten des einst übermächtigen Vaters herausgetreten. Obwohl Thomas Harlan seit Jahren in einem Lungensanatorium lebt, hat er nichts von seinem Temperament verloren, wie Christoph Hübners spannendes Porträt zeigt. „Hübner lässt die Kamera laufen, stellt aber keine Frage. Harlan, der seine Erzählung selbstbewusst mit einer kleinen Sentenz abgerundet hatte, sieht sich also genötigt, nach einer kleinen Pause noch einmal anzusetzen. In Momenten wie diesem gewinnt Wandersplitter eine große Dimension: Das Individuum ist ohnehin unaussagbar, die Geschichte ist übermächtig, und doch findet dieser Dokumentarfilm, in dem er keine illustrierenden Szenen, kein Wochenschaumaterial, keinen Firlefanz zeigt, sowohl einen Begriff wie Bilder davon - vom Individuum Thomas Harlan in der Geschichte des 20. Jahrhunderts.“ (Bert Rebhandl, die tageszeitung, 31.8.2007)
am 19.2.2009 um 20.00 Uhr
Vater und Feind
D 2005, R: Susanne Jäger, 62’ Beta SP
Im Alter von 17 Jahren findet Jörg Hejkal 1978 im Kleiderschrank seiner Eltern zufällig Aufzeichnungen, in denen sein Vater den DDR-Geheimdienst über Eigenschaften und gesellschaftliche Ansichten seines Sohnes informiert. Wenig später unternimmt Jörg, geboren 1961 in Halle an der Saale, seinen ersten Fluchtversuch aus der DDR und landet im Gefängnis. Nach seiner Entlassung beteiligt er sich 1984 an der spektakulären Besetzung der amerikanischen Botschaft in Ost-Berlin und erreicht die Ausreise in den Westen, wo er heute in Köln als Fotograf lebt. Susanne Jägers eindringliche Dokumentation ist das Protokoll eines Verrats, den der linientreue, dem Sozialismus ergebene Vater am eigenen Sohn begeht. Die Regisseurin begleitet Jörg Hejkal zu den Stationen seiner Lebensgeschichte, konfrontiert ihn mit den über ihn gesammelten Stasi-Unterlagen und bringt ihn zum Sprechen über sich, seinen Vater als den ärgsten Feind und sein weiterhin höchst gespaltenes Verhältnis zu den Eltern. Am Ende trifft Jörg seinen Vater und seine Mutter in der elterlichen Wohnung in Halle: ein spannungsgeladenes Wiedersehen, das deutlich macht, wie langsam die Vergangenheit vergeht.
am 26.2.2009 um 20.00 Uhr
Nach der Musik
D 2007, R: Igor Heitzmann, 105’
Über 20 Jahre lang führt der berühmte österreichische Dirigent Otmar Suitner ein seltsames Doppelleben: In Ost-Berlin leitet er seit 1964 die renommierte Staatskapelle, genießt zusammen mit seiner Frau Marita besondere Privilegien und gastiert in der ganzen Welt. Fast genauso lange währt seine keineswegs heimliche Liebesbeziehung zu Renate Heitzmann in West-Berlin, die er an den Wochenenden besucht. Dieser Beziehung entstammt sein 1971 geborener Sohn Igor, dessen Leben vom Balanceakt seines Vaters zwischen Ehefrau und Geliebter, Beruf und Privatleben, Ost und West geprägt wird. Mit Nach der Musik gelingt Igor Heitzmann ein wunderbares Künstlerporträt und zugleich die Annäherung an seinen in der Kindheit so oft abwesenden und nun schon alten Vater. Otmar Suitner hat weder seinen Humor noch seine Leidenschaft für Mozart und Strauß eingebüßt. Er erfüllt sogar den Wunsch des Sohnes und dirigiert trotz zittriger Hände noch einmal sein ehemaliges Orchester. „Dazu mischt Heitzmann wohldosiert seine persönliche Perspektive und die der beiden Frauen seines Vaters. [...] Renate und Marita sind die heimlichen Helden in dieser Geschichte, reden ohne Scheu und selbstbewusst von ihrer Liebe. ‚Ich weiß nicht, ob ich stark war. Vielleicht war ich nur blöd, dass ich alles mitgemacht habe’, sagt Marita lachend. Heute geht man bisweilen gemeinsam essen, wirklich eine erstaunliche ménage à trois.“ (Thomas Gehringer, Der Tagesspiegel, 2.6.2008)
am 5.3.2009 um 20.00 Uhr
Vater und Sohn
BRD 1983, R: Thomas Mitscherlich, 88’ Beta SP
Als Psychoanalytiker und Sozialforscher, Hochschullehrer und Publizist war Alexander Mitscherlich (1908-1982) jahrzehntelang einer der herausragenden Intellektuellen der Bundesrepublik. Hatte er als junger Mann noch der „Konservativen Revolution“ um Ernst Niekisch und Ernst Jünger nahegestanden, so gingen sein öffentliches Engagement als Linksliberaler und seine moralische Glaubwürdigkeit nach 1945 vor allem auf seine Rolle bei der kritischen Auseinandersetzung mit den Verbrechen deutscher Mediziner im „Dritten Reich“ zurück. Daneben war Mitscherlich auch ein häufig abwesender, schmerzhaft vermisster Vater von sechs Kindern. Diese Seite seiner Persönlichkeit steht im Zentrum von Vater und Sohn, einem aus dokumentarischem Material und Spielszenen montierten, vielschichtigen Essayfilm, den sein Sohn Thomas Mitscherlich (1942-1998) gestaltet hat. Zu sehen ist ein schon vom Tode gezeichneter alter Mann, dem sein Sohn mal bewundernd, mal voller Zuneigung, mal respektlos begegnet. Thomas Mitscherlich klagt nicht, sondern stellt fest, denkt weiter: „Wäre er, so eine seiner Annahmen, Terrorist geworden, der Vater hätte kein Verständnis, aber großes Interesse gehabt. An seinen Filmen war der Vater nie interessiert, also bescheidet der Sohn sich, begnügt sich mit väterlichem Verständnis. Für Thomas Mitscherlich leistet der Film [...] sicherlich das, was eine Psychoanalyse leisten sollte: Ich-Findung und Selbstbestimmung.“ (Anne Frederiksen, Die Zeit, 3.5.1985)
am 12.3.2009 um 20.00 Uhr
Alt om min far
Alles über meinen Vater
N/DK 2001, R: Even Benestad, 75’ OmeU
Was tun, wenn der eigene Vater lieber eine Frau ist? Der Filmemacher Even Benestad besucht seinen Vater Esben, von dem sich seine Mutter hatte scheiden lassen, weil sie seine Fantasien nicht mehr ertragen konnte. Esben ist Transvestit. Er lebt als hochgeschätzter Augenarzt in einer norwegischen Kleinstadt, engagiert sich politisch und schreibt Bücher. Zugleich ist er Esther Pirelli, eine etwas exaltierte Dame, Sexualtherapeutin und Gelegenheitsschauspielerin. Alt om min far porträtiert Even Benestad mit Humor und Zuneigung. Keineswegs verschwiegen werden dabei die Verletzungen, die Esbens Familie durch seine Selbstverwirklichung erfahren hat, und die bis heute andauernden Spannungen. „Benestads Befragung von Vater, Mutter, Schwester und Stiefmutter, in Schwarzweiß gefilmt, ist eine hoch spannende, dialogische Verfertigung von Gedanken und gleichzeitig Konfliktbewältigung in Echtzeit. Es gibt natürlich Streit und Vorwürfe. Ich bin eine Frau, beharrt der Vater, und der Sohn wird wütend: Hättest du mit dieser Einsicht nicht warten können, bis deine Kinder groß genug waren? Die tägliche Wandlung des Vaters zur Frau filmt Benestad in Farbe; dem fremden Identitätserleben, dem sinnlichen Vergnügen an der weiblichen Verkleidung, wird eine eigene filmische Gestalt gewährt. Alles über meinen Vater ist eine überaus faire, intelligente und häufig auch witzige Selbsterfahrungsunternehmung.“ (Daniela Pogade, Berliner Zeitung, 8.2.2002)
am 19.3.2009 um 20.00 Uhr
Mein Vater
BRD 1982, R: Fritz Poppenberg, 87’
Zwei Weltanschauungen prallen aufeinander. Fritz Poppenbergs Vater lebt als Bauer in der Lüneburger Heide, ist 77 Jahre alt und überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus. Sein Sohn, der Filmemacher, hat den Wehrdienst verweigert und die Hoffnung des Vaters enttäuscht, dass er einmal den Hof übernehmen werde. Nun sprechen sie miteinander vor der Kamera. Der Vater erzählt von seiner entbehrungsreichen Kindheit und dem Wunsch nach einem starken Mann, vom Verrat an Deutschland, dem Verlust von Ehr- und Pflichtgefühl, von Blut und Boden und der Ausrottung allen Übels: von Krüppeln, Kommunisten, religiös und sexuell Andersartigen. Zugleich zeigt der Vater Wärme und Liebe, wo es um die Natur geht. Ein hermetisch geschlossenes Weltbild tut sich auf, unzugänglich für Argumente und Beweise. Die Zwischenfragen des Sohnes verhallen, die Kommunikation gefriert. „Dieser Film ist keine Analyse, keine Auseinandersetzung mit dem Vater, mit der Geschichte oder mit einem Vater-Sohn-Konflikt. Wie mit erstaunten Kinderaugen blickt die Kamera mit größter Konzentration auf den Vater, als könne und solle er angesichts solch zäher Ausdauer sein eigenes Rätsel lösen. Doch je näher und länger ihm das Bild zu Leibe rückt, desto mehr entzieht sich die Person des Vaters – dem Verstehen ebenso wie der Verurteilung. [...] Diese Studie, so persönlich wie dezent (sie wird an keiner Stelle denunziatorisch), scheint wie ein einziges großes Fragezeichen.“ (Angelika Kaps, Der Tagesspiegel, 23.9.1982)
am 26.3.2009 um 20.00 Uhr
|