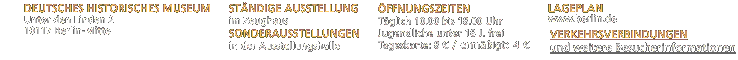SOS MENSCHENRECHTE
Politische und sozial engagierte Filme gibt es seit den Anfängen der Filmgeschichte. Auffällig ist, dass sich in den letzten Jahren Filmproduktionen häufen, die unter dem Label „Menschenrechtsfilm“ funktionieren und nicht nur engagierte Themen in den Vordergrund rücken, sondern auch mit der expliziten Absicht produziert werden, als Kommunikationsmittel für politische Kampagnen oder als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit zu fungieren. Ein Ausdruck dieser Zunahme sind z.B. die wachsende Zahl der Menschenrechtsfilmfestivals auf der ganzen Welt und die Auslobung von Preisen.
Durch das mediale Zusammenrücken der Welt erfährt man heute viel mehr über Menschenrechtsverletzungen in den verschiedenen Ländern. Daher kommt auch das Bedürfnis, Themen wie „Völkermord an ethnischen Minderheiten“, „Rechte der Frauen“, „Beschneidung“, „Kindersoldaten“ oder das Thema „Verstümmelung durch Landminen“ zum Anlass für einen Film zu nehmen. Das Zeughauskino möchte mit seiner Reihe SOS MENSCHENRECHTE die Dringlichkeit der behandelten Themen unterstreichen und zeigt Filme, die sowohl inhaltlich als auch formal interessant sind, die Sensibilität erhöhen und an die Welt appellieren.
Das Programm ist auch eine Hommage an die engagierten Verleiher, die diese Filme in ihr Programm aufnehmen, obwohl viele davon unter kommerziellen Gesichtspunkten als schwer verwertbar gelten müssen.
Eine Filmreihe in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Politische Bildung, amnesty international, der Heinrich-Böll-Stiftung und Handicap International.
SOS - Menschenrechte
Flame
Zimbabwe 1997, R: Ingrid Sinclair, D: Marian Kunonga, Ulla Mahaka, Norman Madowo, Moise Matura, 90’ OmU
Flame alias Florence und Liberty alias Nyasha sind kaum 15, als sie erstmals mit der Befreiungsarmee von Zimbabwe gegen den von Großbritannien gestützten Diktator Ian Smith in Berührung kommen. In einem Camp der Guerilla unterziehen sie sich einer militärischen Ausbildung, die an Härte derjenigen der Männer in nichts nachsteht. Zunehmend werden sie als gleichberechtigte Partnerinnen der Männer anerkannt. Umso bitterer ist ihre Enttäuschung, als nach dem Sieg von ihnen erwartet wird, dass sie nun wieder in ihre traditionelle Frauenrolle schlüpfen sollen – wie Aschenputtel in ihre alte Schürze.
Schon vor Ende der Dreharbeiten wirbelte Ingrid Sinclairs Flame in Zimbabwe viel Staub auf: dass Flame auch die Vergewaltigung von Kämpferinnen durch ihre Genossen nicht ausspart, hat im nachrevolutionären Zimbabwe den Zorn der Veteranenverbände hervorgerufen. Mit der Begründung, der Film enthalte pornografische Szenen beschlagnahmte die Polizei das belichtete Material und rief nach einem Verbot des Films. Nach der endgültigen Freigabe durch die Zensurbehörden wurde der Film in Zimbabwe und Südafrika zu einem überwältigenden Kassenerfolg.
Einführung mit dem Schwerpunkt Afrika am 05.09.: Holger Twele,
mit anschließender Diskussion
Eintritt frei.
In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Politische Bildung.
am 05.09.2006 um 20.00 Uhr, am 08.09.2006 um 19.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Lost Children – Verlorene Kinder
D 2005, R: Oliver Stoltz, Ali Samadi Ahadi, 103’ OmU
Seit nun fast 20 Jahren herrscht im Norden Ugandas Bürgerkrieg zwischen der Rebellenbewegung und der Regierungsarmee. Die vom religiösen Sektierer Joseph Kony angeführte „Lord’s Resistance Army” (LRA) hat kein politisches Programm außer Terror und einer diffusen Torpedierung der Regierung des Präsidenten Museveni im Süden, der seit 1986 an der Macht ist. Über 200.000 Menschen fielen diesem sinn- und gnadenlosen Krieg bislang zum Opfer. Die Strategie der bis in den Südsudan hinein operierenden LRA besteht darin, Kinder zu entführen, um sie als billige und skrupellose Soldaten zu missbrauchen. Schätzungsweise 20.000 Kinder wurden seit 1986 durch die LRA verschleppt.
In Lost Children vertiefen sich die beiden deutschen Filmemacher Ali Samadi Ahadi und Oliver Stoltz in vier Einzelschicksale, z.B. das des achtjährigen Opio, der zu klein ist, um auf den Fahrradsattel zu klettern, doch groß genug, ein Killer zu sein. Im Auffanglager Pajule werden Kinder wie Opio medizinisch und psychologisch betreut und darauf vorbereitet, wieder in ihre Dörfer zurückzukehren – wo sie meist unerwünscht sind.
Lost Children ist eine Gratwanderung. Der Film erzählt von unvorstellbaren Grausamkeiten und will doch Hoffnung geben. Er präsentiert kaltblütige Täter – die ebenso geschundene Kinder sind. Und er weist auf ein Verbrechen hin, welches die Weltgemeinschaft übersieht.
Einführung: Else Engel (amnesty international), mit anschließender Diskussionam
am 06.09.2006 um 20.00 Uhr, am 12.09.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Der irrationale Rest
D 2005, R: Thorsten Trimpop, 95'
1987 versucht Suses Freund Matthias mit ihrer besten Freundin Susanne aus der DDR zu fliehen. Die Flucht scheitert. Matthias und Susanne werden inhaftiert, von der Stasi verhört, psychisch gefoltert, zum Verrat gezwungen. Suse bleibt allein zurück; später muss sie wegen der Flucht ihrer Freunde die Hochschule verlassen. Erst sechzehn Jahre später treffen die drei sich wieder. So eng sie früher zusammen lebten, so weit haben sie sich in der Zwischenzeit voneinander entfernt. Matthias, den die Ereignisse von damals nie losgelassen haben, führt jetzt Besuchergruppen durch das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Susanne, die mit der Vergangenheit nie wieder konfrontiert werden wollte, arbeitet inzwischen als Krankenschwester im Westen Berlins. Suse lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern als einzige noch immer in Pankow, jenem Bezirk, in dem die drei ihre Jugendzeit verbracht haben.
Thorsten Trimpop begleitet die drei Protagonisten an die Orte der Vergangenheit zurück. Der Film zeigt, wie schmerzhaft die Erinnerung selbst nach 20 Jahren noch ist und wie aus Liebe und Freundschaft tiefes Misstrauen wurde. Trimpop wartet mit keinen neuen Enthüllungen zum Thema Stasi-Terror auf, sondern stellt sich der Aufgabe, nachfühlbar zu machen, wie in einem totalitären Staat selbst die engsten sozialen Beziehungen infiziert wurden.
am 13.09.2006 um 20.00 Uhr, am 19.09.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Hotel Rwanda
Hotel Ruanda
Südafrika/ GB/ I/ Can 2004, R: Terry George, D: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte, Joaquin Phoenix, 122’ OmU
Am 7. April 1994 brach in Ruanda der Bürgerkrieg zwischen den regierenden Hutu-Milizen und den Rebellen der Tutsi aus. In nur 100 Tagen starben eine Million Tutsi und gemäßigte Hutus durch die Hand der Milizen, während die gesamte zivilisierte Welt vor einem der brutalsten Kapitel der gesamten Menschheitsgeschichte die Augen verschloss.
Hotel Ruanda erzählt ein heroisches Kapitel aus dem Leben eines ganz gewöhnlichen Mannes, Paul Rusesabagina (Don Cheadle), der als Manager eines Vier-Sterne-Hotels in Kigali 1.268 Menschen vor dem sicheren Tod rettete. Terry Georges Film rekapituliert darüber hinaus auch das Versagen der UN – auf dem Höhepunkt des Mordens wurde die Anzahl der in Ruanda stationierten Blauhelm-Soldaten zum Beispiel von 2.500 auf 270 dezimiert – , er findet nachwirkende Bilder für den Schrecken und ruht sich zu keiner Zeit auf den guten Taten seines Protagonisten aus.
Der ruandische Völkermord sei die Spätfolge eines von der belgischen Kolonialmacht erst geduldeten, dann geförderten und schließlich außer Kontrolle geratenen ethnischen Konfliktes, erklärte Paul Rusesabagina während der Berlinale 2005, wo der Film außer Konkurrenz im Hauptprogramm lief.
Der ehemalige Hotelmanager fungierte bei dem Projekt als Berater und Co-Autor.
am 15.09.2006 um 19.00 Uhr, am 20.09.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Lilja 4ever
Lilya 4-ever
S/ DK 2002, R: Lukas Moodysson, D: Oksana Akinshina, Artjom Bogutscharski, Pavel Ponomarjow, Ljubov Agapova, 109' OmU
Eine 16-Jährige, die in einer namenlosen nordrussischen Stadt von ihrer Mutter im Stich gelassen wurde, durchleidet alle Phasen der Entfremdung und Vereinsamung. Als sie an einen Zuhälterring in Schweden ‚vermittelt’ wird, beraubt man sie ihrer letzten Würde. Einziger Ruhepunkt in ihrem Leben ist ein elfjähriger Freund, der ihr am Ende in Gestalt eines Engels den Selbstmord als einzige Alternative offenbart.
Lilyas Peiniger sind zwar gesichtslos, dabei aber sehr reale Männer, die ihr Leben in einen ausweglosen Albtraum verwandelt haben. „Lilya 4-ever ist ein Film,der das Phänomen der Zwangsprostitution von Frauen und Mädchen in ein prototypisches Einzelschicksal übersetzt.“ (Katja Lütghe, Frankfurter Rundschau))
Vielleicht hat Lukas Moodysson es nicht in Gang gesetzt, zumindest aber doch befördert, dass die schwedische Politik sich 2003 bewegen ließ, ‚Menschenhandel zu sexuellen Zwecken’ als Straftatbestand einzuführen. Außerdem haben Frauen, die in Gerichtsverfahren gegen Zuhälter ausgesagt haben, ein vorübergehendes Bleiberecht in Schweden erhalten. Der Lilya im Film hätten diese administrativen ‚Kleinigkeiten’ schon geholfen.
am 22.09.2006 um 19.00 Uhr, am 26.09.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Rabbit-Proof Fence
Long Walk Home
AUS 2002, R: Phillip Noyce, D: Evelyn Sampi, Tianna Sansbury, Laura Monaghan, Kenneth Branagh,
94' OmU
Die australische Regierung ließ 1907 zwischen dem Norden und Süden des Kontinents einen Zaun gegen die Kaninchenplage errichten. Drei Mädchen wird er 24 Jahre später zur 1.500 Meilen langen Leitschnur, um in ihr Heimatdorf zurückzufinden: Long Walk Home erzählt auf der Basis eines autobiographischen Romans von Doris Pilkington („The Rabbit-Proof Fence“) die authentische Geschichte dreier Mischlingskinder, die von ihren Familien getrennt und in ein Umerziehungsheim verschleppt worden waren. Dort sollten sie nach den Direktiven der australischen Rassenpolitik ‚entwildert’ und als Hauspersonal für die Kolonialherren nutzbar gemacht werden. Molly (Evelyn Sampi), Daisy (Tianna Sansbury) und Gracie (Laura Monaghan) jedoch reißen aus und fliehen durch die endlose rote Wüste nach Hause – immer entlang des besagten Kaninchenzauns.
Ein Kapitel australischer Geschichte, das lange vertuscht und verschwiegen wurde, obwohl die behördlich organisierten Entführungen bis 1971 andauerten. Erst 1997 machte eine Kommission für Menschrechte und Gleichberechtigung das Ausmaß und die Folgen der Zwangsassimilierung öffentlich, der zwischen 1910 und 1976 über 100.000 Kinder unterworfen wurden. Zwei Jahre später wurde eine Entschädigung von 63 Millionen Dollar in Aussicht gestellt, auf die viele der Verschleppten jedoch bis heute warten.
am 27.09.2006 um 20.00 Uhr, am 03.10.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Massaker im Rampenlicht.
10 Filme gegen 100 Millionen Landminen
F/ CH 1999, R: Volker Schlöndorff, Bertrand Tavernier, Pierre Jolivet, Youssef Chahine, Mathieu Kassovitz, Jaco van Dormael, Coline Serreau, Fernando Trueba, Pavel Lungin, Rithy Panh, 45' OmU Beta SP
Deponiert auf Feldern, Straßen, Fußwegen sind Landminen in jedem dritten Entwicklungsland auf dieser Welt zu einer „Massenvernichtungswaffe in Zeitlupe“ geworden. Opfer von Minen sind in der Regel Zivilisten, darunter besonders viele Kinder. Wer von einer Mine verstümmelt wird, ist für sein Leben gezeichnet. Niemand kennt die genaue Zahl aller Opfer von Landminen, aber nach UNO-Angaben kommen jeden Monat mindestens 2.000 neue hinzu. Ein Ende ist nicht abzusehen, da viele Staaten weiterhin Minen produzieren, exportieren und einsetzen, demgegenüber jedoch eine ausreichende finanzielle und organisatorische Unterstützung für Minenräumprojekte und Opferhilfe ausbleibt.
Handicap International, eine internationale humanitäre Organisation, setzt sich seit 1982 für die Belange von (Kriegs)-Behinderten ein, organisiert Kampagnen, Nothilfe- und Entwicklungsprojekte. Im Rahmen der internationalen Aktivitäten gegen Landminen und zur Vorbereitung der Konferenz in Ottawa im Dezember 1997 haben sich auf Initiative der Organisation und Bertrand Taverniers zehn namhafte Regisseure bereit erklärt, jeweils einen kurzen Film zum Thema Landminen zu drehen.
Einführung: Cordula Schuh (Handicap International )
Handicap International freut sich über eine kleine Spende statt des Eintrittsgeldes.
am 29.09.2006 um 19.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Massaker
D/ CH/ Libanon/ F 2004, R: Monika Borgmann, Lokman Slim, Hermann Theissen, 98' OmU
1982 erschütterte ein Massaker in zwei libanesischen Palästinenserlagern die Weltöffentlichkeit. Vom 16. bis 18. September wüteten Soldaten der Forces Libanaises, einer mit Israel verbündeten christlichen Miliz, in Sabra und Shatila: Am Ende hatten sie zwischen 1000 und 3000 palästinensische Zivilisten ermordet. Die genaue Zahl der Opfer, der Toten und Verschwundenen, ist bis heute nicht bekannt.
Ohne das Massaker rekonstruieren zu wollen, zeigt der Film durch die Erzählungen der sechs Protagonisten eine bislang unveröffentlichte Version der Ereignisse: die der Täter
„Die Libanesen sitzen in kargen Zimmern, Stuhl, Glühbirne, ein Bett, nackte Wände. Das garantiert Anonymität: Die Männer wurden generalamnestiert, ihre Geschichte kennt kaum jemand. Einer zeichnet auf Packpapier das Lager nach, rekonstruiert, teils minutiös. Die Vorgeschichte: Folter schon in der Ausbildung. Der unbedingte Gehorsam. Das Morden als Geschwindigkeitswettbewerb. Die irrsinnige Logik des Tötens von Frauen, Kindern, Pferden und Katzen. Der Krieg findet in Worten statt. Im Kopf.“ (Christiane Peitz)
am 04.10.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Moolaadé - Bann der Hoffnung
F/ Senegal/ Burkina Faso/ Kamerun/ Marokko/ Tunesien 2004, R: Ousmane Sembène, D: Fatoumata Coulibaly, Maimouna Hélène Diarra, Salimata Traoré, Dominique Zeïda, Mah Compaoré, Aminata Dao, 120' OmU
Der Film ist eine eindrucksvoll in Szene gesetzte Parabel über die Tradition der Beschneidung junger Mädchen in Afrika sowie den mutigen Kampf einer jungen Frau gegen die aktuelle Praxis dieses Rituals.
Die Eröffnung ist spektakulär. In einer komplexen Plansequenz ‚filtert’ Sembène aus der topographischen und sozialen Gesamtheit eines Dorfes einen einzelnen Hof heraus: Vier Mädchen, denen die Beschneidung droht, stürzen panikartig dorthin und suchen Schutz bei einer Frau. Diese will den Kreislauf der Zerstörung stoppen und errichtet einen Zauber: Moolaadé. Somit können die Frauen, die die Beschneidungen vornehmen wollen den Hof nicht betreten, bis der Fluch aufgehoben ist.
Sembène, der inzwischen 83-jährige Pionier des modernen westafrikanischen Kinos, legt die Machtstrukturen der Gemeinschaft offen und zeichnet seine Figuren sehr facettenreich und ambivalent. Im Zentrum seiner Filme stehen die postkolonialen Wechselwirkungen der verschiedensten Kulturen und vor allem auch die Probleme Schwarzafrikas unter dem Druck der Globalisierung.
Seit Jahren wird der Regisseur nicht müde, in Interviews zu betonen, dass Afrika nur durch die Arbeit der Frauen überlebe. Nach Faat Kine (2001) ist Moolaadé der zweite Film einer Trilogie, die das Leben der Frauen als Heldinnen des Alltags würdigt.
am 10.10.2006 um 20.00 Uhr, am 13.10.2006 um 18.30 Uhr
SOS - Menschenrechte
Bread and Roses
Brot und Rosen
GB/ E/ F/ D/ I/ CH 2000, R: Ken Loach, D: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, 110' OmU
Maya, eine von Schleppern in die USA eingeschmuggelte Mexikanerin (Pilar Padilla) findet bei der Familie ihrer Schwester Rosa (Elpidia Carillo) in Los Angeles Unterschlupf und einen Job in einer Reinigungsfirma. Dort schließt sie sich dem jungen Gewerkschafter Sam (Adrien Brody) an und hilft, die ausbeuterischen und rechtlosen Arbeitsbedingungen zu bekämpfen, ehe sie wegen eines Diebstahls abgeschoben wird.
„Für diesen Film hat sich Loach einen Brennpunkt der Globalisierung ausgesucht und sich dafür weit ins Feindesland vorgetraut, bis nach Hollywood. Mit Bread and Roses kämpft er so ein weiteres Mal an zwei Fronten zugleich: Gegen die Lohndrücker und Ausbeuter sowie gegen die überkommene Kino-Ästhetik, die Helden, wie er sie bevorzugt, nie ins Zentrum stellen würde.“ (Barbara Schweizerhof, Freitag)
Im Mittelpunkt von Loachs Film steht so auch nicht, wie zu erwarten wäre, die Love-Story zwischen Sam und Maya, sondern der Konflikt zwischen den Schwestern: der rebellisch-naiven Maya und der desillusionierten Rosa, die schließlich gar die Kollegen verrät, um nicht selbst gefeuert zu werden.
„Eine in dokumentarischem Handkamera-Stil gedrehte hoffnungsvolle Utopie über die Kraft des Einzelnen und die Solidarität mit Entrechteten, authentisch gespielt von professionellen wie von Laiendarstellern. Auf den ersten Blick ‚altmodisch’, trifft der Film genau die Balance zwischen engagiertem Thesenstück und unterhaltsamem Politkino.“ (Lexikon des internationalen Films)
am 11.10.2006 um 20.00 Uhr, am 17.10.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
All the Invisible Children
Alle Kinder dieser Welt
I/ F 2005, R: Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo, 116' OmU
Am Anfang stand eine Idee, die ebenso zwingend wie nahe liegend war: Wie wäre es, all den Kindern, deren Schicksal sonst einer großen Öffentlichkeit verborgen bleibt, in einem Film eine Stimme zu geben? Um die verschiedenen Regionen der Welt und deren spezifische Probleme angemessen zu repräsentieren, dachten die Initiatoren von Anfang an an ein Omnibus-Projekt, also einen Episodenfilm, in dem verschiedene Regisseure ihre jeweilige Sicht realisieren würden können. Auf Vermittlung des italienischen Ministeriums für Entwicklungshilfe kam man in Kontakt mit verschiedenen Institutionen, die begeistert ihre Unterstützung zusagten, so etwa das WFP (World Food Programme) und die UNICEF.
Die einzelnen Filme beleuchten in sieben Variationen das Leben von Kindern in unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen – von Straßen-Kids in São Paulo über Kinder drogenabhängiger Eltern in Brooklyn bis zu bewaffneten jungen Freiheitskämpfern in Tansania. Die Botschaft aller Filmemacher: Kinder sind viel zu oft auf sich alleine gestellt und haben zu wenig Schutz und Unterstützung.
„Insgesamt überzeugen die Filme sowohl erzählerisch als auch visuell. Die Kinder kommen nicht nur als Mitleidsobjekte vor, sondern als starke Charaktere. (Titel der einzelnen Filme: 1. Tanza; 2. Blue Gipsy; 3. Jesus Children of America; 4. Bilu e Joao, 5. Jonathan, 6. Ciro, 7. Song Song & Little Cat).“ (Lexikon des internationalen Films)
am 18.10.2006 um 20.00 Uhr, am 24.10.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
La petite vendeuse du soleil
Die kleine Verkäuferin der Sonne
Senegal/ CH 1998, R: Djibril Diop Mambéty, D: Lissa Baléra, Tairou M'Baye, Oumou Samb, 45' OmU
Sili ist etwa zwölf Jahre alt und kann nur mit zwei Krücken gehen. Sie kommt nach Dakar, weil sie für ihre blinde Großmutter sorgen und Geld verdienen muss. Eine Chance dazu wäre das Verkaufen von Zeitungen in den Straßen. Doch die Jungen der Stadt wollen sich ihr altes Vorrecht nicht nehmen lassen. Sili wird so heftig von ihnen angerempelt, dass sie stürzt und die Krücken meterweit von ihr wegfliegen. Nur mit großer Mühe kann sie sich wieder aufrichten. Doch sie lässt sich von diesem Zwischenfall nicht entmutigen und am nächsten Tag verkauft sie wiederum Zeitungen. Denn was für Männer gilt, muss auch für Frauen gelten...
Die kleine Verkäuferin der Sonne ist der zweite Teil einer geplanten Trilogie, mit der Regisseur Mambéty dem Mut der Straßenkinder die nötige Anerkennung zollen wollte. Kurz nach den Dreharbeiten verstarb er am 23. Juli 1998 in Paris.
Kisangany Diary
A 1997, R: Hubert Sauper, 45' OmU
Entlang einer überwachsenen Eisenbahntrasse am südlichen Ufer des Kongo-River werden von einer UN-Kommission Flüchtlinge aufgefunden: 80.000 Menschen am Rande des Hungertods. Menschen, die seit drei Jahren vor den Folgen des Bürgerkriegs in ihrer Ruandischen Heimat fliehen. Mit seinem Film verfolgt Hubert Sauper ihre Spuren bis tief in den Tropenwald, begleitet einige hilflose Rettungsversuche, geht an rätselhafte Orte, die noch am Tag davor Schauplatz von brutalen Massakern waren. Niemand weiß, wer die Täter waren. Grauenhafte Gewissheit aber ist, dass, während wir den Film sehen, die meisten Menschen, denen man darin begegnet, kurz nach den Aufnahmen nicht mehr am Leben waren.
Anlässlich seines Films Darwins Alptraum (2005) äußerte Hubert Sauper in einem Interview mit der Wiener Tageszeitung Der Standard: „Ich sehe meine Arbeit weniger im Aufdecken als im Entdecken. Was Kisangany Diary angeht: Der Film ist im Krieg gedreht worden – und die Kamera hat mehr aufgenommen, als ich begreifen konnte. Im Schnitt habe ich entschieden, viele Informationen herauszunehmen. Was ich gelassen habe, ist meine Sprachlosigkeit und Angst. Als Autor ist man auch damit konfrontiert, was man fühlt.“
am 20.10.2006 um 19.00 Uhr, am 25.10.2006 um 19.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Safa Re Ghandehar
Reise nach Kandahar
Iran/ F 2001, R: Mohsen Makhmalbaf, D: Niloufar Pazira, Hassan Tantai, Sabou Teymouri, 85' OmU
Die junge Kanadierin Nafas (Niloufar Pazira) wurde in Kandahar geboren und flüchtete mit ihrer Familie als sie 16 Jahre alt war. Doch nun, einige Jahre später, muss sie sich wieder in ihre Heimat aufmachen, um ihre Schwester zu retten. Diese plant, sich bei der letzten Sonnenfinsternis des Jahrtausends (der Film spielt 1999) umzubringen. Aus diesem Grund wird Nafas als dritte Frau eines Bekannten aus dem Irak nach Afghanistan einreisen, denn nur so, und mit der lebenswichtigen UNO-Fahne, kann sie es schaffen. Als die Familie des Freundes überfallen wird und in den Irak umkehrt, reist Nafas allein weiter. Die Frau macht sich auf den beschwerlichen Weg durch eine Wüstenlandschaft und eine von Armut, Kriegselend und Unterdrückung gezeichnete Gesellschaft. Der Film beschreibt, als erstes fiktionales Werk, in Form eines Reisetagebuchs die repressiven Zustände unter dem radikal-islamischen Taliban-Regime.
Befragt, was die Hauptfigur für ihn bedeute, antwortete Makhmalbaf in einem Interview: „Sie symbolisiert die afghanische Frau, die in Kanada ein besseres Leben entdeckt hat. Sie will nach Hause zurückkehren, fühlt sich aber nicht wie die durchschnittliche afghanische Frau, welche für die Männer bloß ein rechtloses Haremmitglied ist. Nafas ist ein afghanischer Name und bedeutet ‚Atmung’. Die Burka hindert die Frauen am Atmen und schränkt sie in ihrer Freiheit ein.“ (www.movienetfilm.de)
am 31.10.2006 um 20.00 Uhr, am 05.11.2006 um 21.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Grbavica
Esmas Geheimnis
A/ Bos/ D/ Kroatien 2006, R: Jasmila Zbanic, D: Mirjana Karanovic, Luna Mijovic, Leon Lucev, 90' OmU
Grbavica ist der Name einer Vorstadt Sarajevos und in Bosnien heute auch ein Synonym für die systematische Gewalt, die Frauen während des Bosnienkrieges angetan wurde. Viele dieser Frauen wurden wider Willen geschwängert und gezwungen, die Kinder auszutragen.
Die allein erziehende Esma möchte ihrer 12-jährigen Tochter Sara die ersehnte Teilnahme an einer Klassenfahrt ermöglichen. Mit einem Nachweis, der bestätigt, dass Saras Vater ein Kriegsheld war, würde sie eine Ermäßigung bekommen. Aber Esma wehrt Saras Fragen nach der Bescheinigung ab. Sie versucht, das Geld für den Ausflug ihrer Tochter aus eigener Kraft aufzutreiben. Sie ist davon überzeugt, dass sie das Geheimnis um den Vater von Sara bewahren muss, um ihre Tochter und nicht zuletzt auch sich selbst zu schützen.
„Mehr wird hier eigentlich nicht erzählt - nur die Geschichte mit dem fehlenden Dokument und dem Geld für die Klassenreise, die kleine Geschichte, in der die große Geschichte auf diskrete und konkrete Weise aufgehoben ist. (…) Das sind unaufdringliche, alltägliche Bilder, hinter denen zwar etwas Unheimliches spürbar wird, die aber verzichten auf jegliche Rückblenden, auf Opferkitsch, Männerhass, Kriegsszenen oder Traumflashs und dergleichen mehr. Alles passiert hier jenseits der Klischees, jenseits der Eitelkeiten.“ (Caroline Fetscher, Der Tagesspiegel)
Grbavica wurde mit dem Goldenen Bären des Wettbewerbs der Internationalen Filmfestspiele 2006 ausgezeichnet.
Einführung am 01.11.: Simone Schmollack (Heinrich-Böll-Stiftung)
In Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung.
am 01.11.2006 um 20.00 Uhr, am 04.11.2006 um 21.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Weiße Raben - Albtraum Tschetschenien
D 2005, R: Johann Feindt, Tamara Trampe, 96' OmU Beta SP
Petja und Kiril melden sich – gerade 18 Jahre alt – freiwillig zum Einsatz an der tschetschenischen Front. Die Krankenschwester Katja arbeitet in einem Lazarett im Kriegsgebiet. Keiner von ihnen kehrt zurück, wie er ging. An Leib und Seele verkrüppelt und allein gelassen mit ihren Erfahrungen von Verstümmelungen, Folter und Tod führen sie fortan ihr eigenes Leben weiter.
Drei Jahre lang haben die Filmemacher Tamara Trampe und Johann Feindt eine Krankenschwester und zwei Rekruten beobachtet, die von ihrem freiwilligen Einsatz in Tschetschenien zurückkamen in eine Gesellschaft, die sie gar nicht wahrnehmen möchte. Ansprechpartner waren die Frauen vom „Komitee der Soldatenmütter Russlands“, die für die Opfer auf beiden Seiten dieser Metzelei schon Unglaubliches geleistet haben.
Die Interviews mit den Kriegsheimkehrern, die sich alle aus Geldnot nach Grosny schicken ließen, zeigen hilflose Jugendliche, die das Erlebte zu verdrängen versuchen. Wir lernen ihre verzweifelten Eltern kennen, die um Unterstützung des Staates kämpfen müssen und nicht mehr verstehen, was in den ehemaligen Soldaten, den „Weißen Raben“, vorgeht.
am 03.11.2006 um 21.00 Uhr, am 04.11.2006 um 19.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Takhte Siah
Schwarze Tafeln
Iran/ I/ Japan 2000, R: Samira Makhmalbaf, D: Said Mohamadi, Bahman Ghobadi, Behnaz Jafari, 85' OmU
Vom Krieg gezeichnet ist der iranische Teil Kurdistans. Zwei Lehrer wandern mit großen Schultafeln auf dem Rücken durch die karge gebirgige Grenzlandschaft Richtung Irak, um sich auf der Suche nach Schülern Verpflegung und Unterkunft zu verdienen. Der Eine schließt sich einer Gruppe von Kindern an, der Andere begegnet Nomaden. Die Geschichten der zwei Männer werden parallel erzählt. Im Kampf ums Überleben opfern beide ihre Schultafeln, weil ihre sozialen und humanitären Fähigkeiten mehr gefragt sind als ihre pädagogischen.
Nach Der Apfel war Schwarze Tafeln der zweite Spielfilm der damals erst 20-jährigen Samira Makhmalbaf – Tochter von Mohsen Makhmalbaf, der als Produzent und Co-Autor fungierte – und ein weiteres Meisterwerk des jungen, humanistischen und politisch engagierten Kinos aus dem Iran förderte. Beim Festival von Cannes 2000 errang Schwarze Tafeln den Großen Preis der Jury und wurde zum bis dahin erfolgreichsten iranischen Film auf der Weltbühne des Kinos.
„Man stelle sich ein absurdes Epos wie von Pasolini vor, an die iranisch-irakische Grenze verlegt, gedreht mit einem wachen Blick für die harsche Landschaft, und man kommt Samira Makhmalbafs Schwarze Tafeln schon recht nahe. Ihre Geschichte zweier umherziehender Lehrer, die Worte für Brot eintauschen wollen, mischt surreale Episoden mit realen Kriegs-Traumata. Ein politisch mutiger und künstlerisch faszinierender Film.“ (Sight and Sound)
am 07.11.2006 um 20.00 Uhr, am 10.11.2006 um 19.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Yan Mo – Vor der Flut
China 2005, R: Yan Yu, Li Yifan, 150' OmeU Beta SP
Nach 12 Jahren Bauzeit ist im Mai dieses Jahres in China der größte Staudamm der Welt eingeweiht worden. 2008 soll er in Betrieb gehen. Über eine Million Menschen mussten dafür umgesiedelt werden, die meisten von ihnen haben bis heute von der Regierung keine Entschädigungszahlungen dafür erhalten. Hunderte von Städten und ganze Landstriche werden zukünftig unter der Wasseroberfläche verschwinden. Dazu gehört auch die 50.000 Einwohner Stadt Fenje.
„Yan Mo – Vor der Flut ist ein aufwühlendes Dokument dieser großen Menschenverschiebung. Er blickt auf die Einzelschicksale und schwelenden Konflikte, die nicht Teil der offiziellen Berichterstattung sind. Denn die chinesische Regierung verfährt mit dem Volk nicht anders als mit den wegzuschaufelnden Landmassen...“ (Freunde der Deutschen Kinemathek)
am 08.11.2006 um 20.00 Uhr, am 10.11.2006 um 21.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
We Feed the World
A 2005, R: Erwin Wagenhofer, 96' OmU
„Wenn Sie wissen wollen, warum unsere Hühner den Regenwald auffressen und 25% der Brasilianer hungern, dann sollten Sie Erwin Wagenhofers We Feed the World anschauen. Die Dimensionen des Problems sollte man sich bei dieser Gelegenheit auch noch mal richtig vorbuchstabieren: Ist doch Brasilien keineswegs ein ‚klassisches’ Hungerland, sondern im Gegenteil eines der reichsten Agrarländer überhaupt und außerdem größter Sojaexporteur der Welt.
Tomaten, die in Steinwolle wachsen, Brot, das weggeworfen wird, Fisch ohne Frische, Hybrid-Auberginen ohne Geschmack und das Menschenrecht auf Wasser im Visier von Nestlé, des größten Lebensmittelkonzerns der Erde. Wagenhofers dokumentarische Erzählungen um die Nahrungsproduktion in Zeiten der Globalisierung leben vom Impetus des leidenschaftlichen Reporters. Oberste Priorität: Anschaulichkeit und Verständlichkeit. Scharf und zugespitzt. Blicke in die Kulissen eines Zentralbereichs unseres gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Lebens, der dennoch aus der Wahrnehmung, der Empfindung, dem Wissen gerutscht ist. Kein Schielen auf Skandale. Der Normalfall, sofern man genau hinsieht, ist Skandal genug.
Die mit Digital-Video gedrehten Bilder von We Feed the World erinnern ganz nebenbei auch daran, dass ein Informationsauftrag, den das Fernsehen einst ganz selbstverständlich erfüllte, in Quotenzeiten ans Kino zurückgefallen ist.“ (Ralph Eue, Der Tagesspiegel))
Einführung am 11.11.: Ralph Eue
am 11.11.2006 um 19.00 Uhr, am 12.11.2006 um 21.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Sankofa
USA/ D/ Ghana/ Burkina Faso/ GB 1993, R: Haile Gerima, D: Oyafunmike Ogunlao, Alexandra Duah, Kofi Ghanaba, Nick Medley, Mutabaraku, 125' OmU
Bei Aufnahmen eines weißen Fotografen an der Küste von Ghana wird ein schwarzes Fotomodell aus den USA durch einen Trommler in Ekstase versetzt. Plötzlich wird die Frau ‚eingefangen’ von der Geschichte des Forts, in dem die Fotos geschossen werden. In ihrer Trance sieht sie sich konfrontiert mit schwarzen Leibern in Ketten, wird hineingestürzt in die Vergangenheit, wird selber ein Teil von ihr. Bilder von Vergewaltigungen, Auspeitschungen und Rebellionen stürzen auf die Frau ein. Sie sieht zerrissene Familien und Geheimbünde.
Deutlich wird, „dass nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen der schwarzen Sklaven geknechtet werden sollten durch die weiße und christliche Religion. Haile Gerima geht dabei nicht linear vor, reiht nicht aneinander, sondern verknüpft assoziativ, so dass sich schließlich ein Geflecht prägnanter Szenen und Sequenzen ergibt. Immer wieder flackern hier Feuer auf, berichten Sklaven von sich selbst oder Verwandten. Diese Art der ‚Oral History’ ist Erzählung, Überlieferung, Ritual und Beschwörung zugleich. Es ist eine eigene Sprache, es ist ein eigener Rhythmus, mit denen sich Gerima unter anderem löst von der vorgestanzten Erzählweise Hollywoods.“ (Stuttgarter Zeitung)
am 11.11.2006 um 21.00 Uhr, am 14.11.2006 um 20.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Private
I 2004, R: Saverio Costanzo, D: Mohammed Bakri, Lior Miller, Hend Ayoub, Tomer Russo, Arin Omary, 90' OmU
Mohammad (Mohammed Bakri) lebt mit seiner Familie im Niemandsland zwischen einem palästinensischen Dorf und einem israelischen Militärstützpunkt. Eines Nachts dringen israelische Soldaten in sein Haus ein und besetzen es. Die Familie jedoch weigert sich, ihr ‚zu Hause’ zu verlassen. Die Besatzer belegen daraufhin die obere Etage, während sich Mohammad, seine Frau und die fünf Kinder nur noch im Erdgeschoss aufhalten dürfen und in der Nacht gar in ihr eigenes Wohnzimmer eingesperrt werden.
Die sieben Familienmitglieder gehen höchst unterschiedlich mit dieser grotesken und explosiven Situation um. Von Widerstand durch reine Anwesenheit über Fluchtgedanken bis zu surrealistischen Gewaltphantasien reicht das Spektrum ihrer Strategien.
Die Kontrahenten sind authentisch gezeichnet, ebenso die subtile Darstellung der immer lauernden Gefahr von Gewalt und Tod. Daneben gibt es angedeutete Momente der Entspannung zwischen Besatzern und Besetzten, die den Film zu einem eindrücklichen Tanz auf des Messers Schneide der Gefühle machen.
Private gewann 2004 die beiden Hauptpreise des Filmfestivals von Locarno – für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller.
am 15.11.2006 um 20.00 Uhr, am 17.11.2006 um 21.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Drum
Südafrika/ USA/ D 2004, R: Zola Maseko, D: Taye Diggs, Gabriel Mann, Jason Flemyng, Tumisho Masha, 95' OmU
Drum von Zola Maseko spielt 1951 in Südafrika zur Zeit des Apartheidregimes der Buren. Erst 1994 nach einem langen Befreiungskampf der Schwarzen und um den Preis vieler Tausender Toter ging diese rassistische Ära zu Ende.
Henry Nxumalo tritt 1951 als erster schwarzer Journalist in Johannesburg in die Redaktion der gerade gegründeten südafrikanischen Lifestyle-Zeitschrift „Drum“ ein. Deren Eigentümer und Herausgeber, ein weißer britischer Landbesitzersohn, möchte eine Marktlücke füllen und ein Magazin schaffen, das die überwiegend schwarze Bevölkerung Südafrikas anspricht. Nxumalo arbeitet zunächst als Sportreporter, doch schon bald treiben ihn die Ungerechtigkeiten des Apartheid-Staates immer häufiger dazu, auch die sozialen Missstände aufzugreifen. Unter Lebensgefahr recherchiert Nxumalo zusammen mit dem gerade mal 20-jährigen deutschen Fotografen Jürgen Schadeberg zum Beispiel, wie schwarze Arbeiter/innen auf einer Buren-Farm noch mit der Peitsche traktiert und wie schwarze Häftlinge in einem berüchtigten Gefängnis misshandelt werden. Dank seiner Artikel avanciert das Magazin „Drum“ schnell zur Plattform für Regime-Kritik. Nxumalo selbst wird als „Mr. Drum“ berühmt, erregt aber zugleich das Missfallen der Machthabenden, deren weiße Handlanger ihn vor weiteren investigativen Aktionen zur sozialen Lage warnen.
Einführung am 17.11.: Michael Esser
am 17.11.2006 um 19.00 Uhr, am 18.11.2006 um 21.00 Uhr
SOS - Menschenrechte
Osama
Afghanistan/ NL/ Japan/ Irland/ Iran 2003, R: Siddiq Barmak, D: Marina Golbahari, Arif Herati, Zubaida Sahar, Gol Rahman Ghorbandi, 83' OmU
Osama ist der erste lange Spielfilm, der nach dem Ende der Taliban-Herrschaft in Afghanistan gedreht wurde.
„Hätte mir Gott doch bloß einen Jungen geschenkt!“, klagt die Mutter über die ‚Strafe’, ein Mädchen zu haben. Weder Mann, noch Bruder oder Vater hat ihr der Krieg in Afghanistan gelassen. Unter den Taliban ist Gesetz, dass sich Frauen nur in Begleitung einer männlichen Person in der Öffentlichkeit bewegen dürfen. Ihrer Arbeit als Ärztin kann die Witwe nicht mehr nachgehen. Doch die Großmutter schneidet der Enkelin die Zöpfe ab. Fortan muss das Mädchen als Junge mit dem Namen Osama für den Unterhalt der Familie sorgen. Als es bei der Arbeit von einem Taliban aufgegriffen und in ein Ausbildungslager für Korankrieger gebracht wird, beginnt ein Spießrutenlauf durch eine männerdominierte, religiös-fanatische Welt. Ihr Menstruationsblut verrät sie endgültig, bringt dem Kind Gefängnis und die Verurteilung vor dem Sharia-Gericht ein: Doch sie wird nicht mit dem Tod bestraft, sondern als 12-jähriges Mädchen mit einem alten Mann, dem Mullah, verheiratet. In der Hochzeitsnacht schenkt er ihr ein großes, schön gearbeitetes Vorhängeschloss.
Beim Festival von Cannes, wo Osama 2003 mit Standing Ovations gefeiert und mit einer besonderen Erwähnung der Jury bedacht wurde, erklärte der Regisseur: „Mein Film ist eine Hommage an die Geduld der Afghanen, die so viel Leid erfahren haben. Die Auszeichnung gilt ihrem Widerstand und ihrer unzerstörbaren Hoffnung auf die Zukunft.“
am 18.11.2006 um 19.00 Uhr, am 19.11.2006 um 21.00 Uhr
|