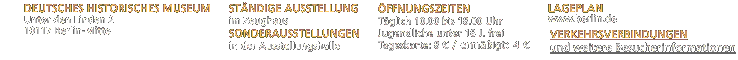Die Planungsgeschichte des
Deutschen Historischen Museums, und damit
letztendlich auch die seines Erweiterungsbaus,
ist eng mit der Entwicklung Berlins in den
Jahren unmittelbar vor und nach dem Fall
der Mauer verbunden.
Noch zu Zeiten des zweigeteilten Deutschlands
wurde der Entschluß der Bundesregierung
gefaßt, auf bundesdeutscher Seite
ein Gegenstück zum Ostberliner ‚Museum
der Deutschen Geschichte', das im barocken
Zeughaus untergebracht war, zu schaffen.
So wurde im Oktober 1987, anläßlich
der 750-Jahr Feier der Stadt Berlin, die
Gründung des Deutschen Historischen
Museums zwischen der Bundesrepublik und
dem Land Berlin beschlossen.
Als Ergebnis des daraufhin folgenden, Europa-weit
geladenen Architektenwettbewerbes, dem als
Bauplatz die Fläche gegenüber
dem Reichstag zugrunde lag, wurde der Entwurf
des italienischen Architekten Aldo Rossi
im Jahre 1988 mit dem 1. Preis bedacht.
Dieser sah einen sehr umfangreichen, aus
mehreren Grossformen zusammengesetzten Museumskomplex
vor, der zahlreiche Sonderausstellungsflächen
umfaßte. Durch den Mauerfall wurde
diese Planung jedoch jäh unterbrochen
und das vorgesehene Grundstück Bestandteil
des ‚Band des Bundes' - jenes städtebaulichen
Masterplans, den der Architekt Axel Schultes
für die neuen Regierungsbauten in Berlin
entwarf.
In dem nun vereinten Berlin
wurde daraufhin im Herbst 1990 die Auflösung
des ‚Museums der Deutschen Geschichte'
beschlossen und dessen Sammlung dem Deutschen
Historischen Museum übertragen. Damit
wurden die beiden Geschichtsmuseen Ost und
West zur ersten gesamtdeutschen Kultureinrichtung
zusammengefügt und das historische
Zeughaus als deren endgültiger Sitz
festgelegt. Da die dort vorhandenen Räumlichkeiten
mit 7.500 m2 Grundfläche jedoch bei
Weitem nicht den ursprünglich geforderten
16.000 m2 (zuzüglich weiteren 5.000
m2 Wechselausstellungsflächen) entsprachen,
wurde eine umfassende Umplanung erforderlich.
Das Zeughaus konnte demzufolge nur die (dann
reduzierte) Dauerausstellung beherbergen,
für Wechselausstellungen wurden zusätzliche
Flächen erforderlich, die aber, der
Museumskonzeption folgend, eine räumliche
Anbindung aufweisen mussten. Naheliegend
erschien daher zunächst die Umnutzung
der bestehenden Depot- und Werkstattgebäude
des ehemaligen Museums für deutsche
Geschichte, die nördlich an das Zeughauses
anschlossen. Deren Umgestaltung zu Ausstellungszwecken
wurde nach eingehender Prüfung jedoch
verworfen: Zu groß waren die Unterschiede
zwischen den bestehenden Lagerflächen
und den hohen Anforderungen gerade an ein
Wechselausstellungsgebäude, unter anderem
auch beispielsweise in sicherheitstechnischer
Hinsicht. Hinzu kam, dass Teile des Bestandes
substantiell geschädigt waren. Daher
wurde durch den Deutschen Bundestag einem
Neubau auf diesem Grundstück zugestimmt
und die in den 50er Jahren während
der DDR Zeit errichteten Gebäude daraufhin
abgerissen.
Für den geplanten Neubau wurde 1996
der Architekt Ieoh Ming Pei, der in New
York lebende, jedoch gebürtige Chinese,
mit dem Entwurf beauftragt.
Pei führt aufgrund seines hohen Alters
nur noch wenige Projekte aus, und recherchiert
Anfragen daher sehr gründlich, bevor
er einen Auftrag annimmt. Ihm ging es in
Berlin nicht allein um die Bauaufgabe, sondern
vor allem auch um das Arbeiten in der neuen
Hauptstadt, im der spannungsreichen Atmosphäre
des nun vereinten Berlin der Nachwendezeit.
Letztendlich war für ihn neben diesen
eher kulturellen Aspekten aber die aussergewöhnliche
Lage ausschlaggebend, da die Integration
dieses städtebaulich schwierigen, von
seiner architektonischen Bedeutung her aber
einzigartigen Grundstücks einen besonderen
Reiz ausstrahlte. Umgeben von so bedeutenden
Bauwerken wie Schinkels Neuer Wache und
dem Alten Museum, sowie dem ab 1695 von
Nehrig, Grünberg und Schlüter
entworfenen Zeughaus liegt es auf der direkten
Verbindung der Straße ‚Unter
den Linden' und der Neuen Wache zur Museumsinsel.
Diese Bedingungen werteten letztendlich
den ungünstigen Zuschnitt und die versteckte
Lage des Bauplatzes auf.
Bei seinen ersten Besuchen in Berlin, bei
denen er sich mit der Gesamtsituation der
Aufgabe vertraut machte, hatte Pei vor allem
die Leere des innerstädtischen Ensembles
beklagt: sein Gebäude ist eine direkte
Antwort darauf und soll mit Transparenz
und nach außen dringendem Licht neue
Aktivität in diese historische Mitte
zurückbringen.
Mit einer Fläche von
wenig mehr als 2000 m2 hat das Grundstück
einen nahezu dreiecksförmigen Zuschnitt:
Im Nordwesten wird es begrenzt durch die
diagonal verlaufende Straße ‚Hinter
dem Gießhaus', im Süden besäumt
von der Gasse ‚Hinter dem Zeughaus',
und, angrenzend an den Verwaltungstrakt
des DHM (dem ehemaligen ‚Minolgebäude')
in Nord/Südrichtung verlaufend durch
die Mollergasse gefaßt. Beide Gassen
sind aus historischer Sicht im Ensemble
des ‚Forum Fridericianum' sehr bedeutend
und es war daher unser Anliegen, die Sichtbezüge
beider beizubehalten. Daher wurden Alt-
und Neubau ausschließlich unterirdisch
verbunden, was sie zu zwei eigenständigen
Gebäuden macht, die zwar in ihren Grundfunktionen
autark voneinander betrieben werden können,
konzeptionell aber aneinander gebunden sind
und daher zu einer symbiotischen Einheit
von Alt und Neu verschmelzen.
Die ehemals enge Gasse ‚Hinter dem
Zeughaus' wird dabei durch eine geschwungene
Glasfassade in einen großzügigeren
Bereich aufgeweitet, der den öffentlichen
Durchgang zwischen altem und neuen Teil
des Deutschen Historischen Museums schafft,
und den Sichtbezug zum Berliner Dom und
dem Fernsehturm erhält.
Der Zugang zum Erweiterungsbau,
aus dem Zeughaus kommend, erfolgt über
den quadratischen Innenhof, den so genannten
Schlüter Hof, der mit einer Glasüberdachung
versehen wurde. Die flache, gläserne
Kuppel wurde gemeinsam mit dem Ingenieurbüro
Schlaich, Bergermann und Partner aus Stuttgart
entwickelt und überspannt den ca. 40
x 40 m großen Hof stützenlos
mit einer leichten Netzstruktur aus Stahl
und Glas. Da die barocken Fassaden das Gewicht
dieser neuen Dachkonstruktion nicht mehr
aufnehmen konnten, wurden in den Gebäudeecken
des Hofes verdeckt liegend neue Stahlstützen
eingezogen, in die alle Lasten eingeleitet
werden. Der nun zu allen Jahreszeiten nutzbare
Raum wird nicht nur eine Durchgangsfläche
sein, sondern durch das angegliederte Restaurant
des Zeughauses belebt und für Sonderveranstaltungen
des Museums zur Verfügung stehen. Durch
diesen Hof erreicht der Besucher den Verbindungsgang,
der bereits einen Durchblick auf das Wechselausstellungsgebäude
freigibt und in seinem Verlauf unterirdisch
in die Glashalle des Neubaus führt.
Da das Zeughaus nicht unterkellert ist,
wurde so in der Mitte des Nordflügels
ein zweigeschossiger überwölbter
Raum eingeschnitten, von dem Rolltreppen
nach unten führen. So kann die unterirdische
Anbindung so selbstverständlich wie
möglich erfolgen, ohne das dies vom
Besucher als Hürde empfunden wird.
Die Ausstellung des Zeughauses, als Rundgang
konzipiert, wird über eine Brücke,
die diesen Einschnitt quert, angebunden.
Vom Verbindungsgang aus gelangt der Besucher
in das Untergeschoß der großzügigen
Glashalle des Neubaus, an die die verschiedenen
Funktionsbereiche angeschlossenen sind:
den weitgehend geschlossenen Ausstellungsbereich
mit ca. 2.600 m2 Grundfläche, der sich
im Grundriss wie ein Tortenstück ablesen
läßt und dem Werkstattgebäude,
das, mit einem kleinen Auditorium ausgestattet,
sich an das bestehende Verwaltungsgebäude
anschmiegt. Die Verbindung dieser Bauteile
erfolgt über mehrere Brücken und
Ebenen, die als Foyerflächen für
Sondernutzungen zur Verfügung stehen.
In dieser Lichtdurchfluteten Glashalle sind
die Transparenz und die Bewegung der Besucher,
das Sehen und ‚Gesehen werden' die
entwerferischen Mittel, mit denen der Bau
die Öffentlichkeit einlädt. Innere
Abläufe sind von außen wie durch
ein Schaufenster ablesbar, wobei gleichzeitig
in der Durchsicht von innen nach außen
die bisher vernachlässigte rückwärtige
Fassade des Zeughauses wie in einen Rahmen
gefaßt präsentiert wird.
Da die Fläche des Grundstücks
gering ist, sind die Ausstellungsflächen
auf insgesamt vier Geschosse verteilt. Jede
dieser Ebenen ist in der großzügigen
Halle durch eine unterschiedliche, repräsentative
Treppe zu erreichen. Damit wird der Besucher
verführt, auch bis in das oberste Geschoß
vorzudringen und wird, unbewußt, fast
in piranesischem Sinne immer wieder neuen
Perspektiven ausgesetzt.
Besonders auffallend ist dabei die Verbindung
von 1. zum 2. Obergeschoß, wo sich
aus dem Glasvolumen der Halle eine weit
auskragende, sehr flach ansteigende, ebenfalls
verglaste Wendeltreppe hinauslehnt, bei
deren Begehen man unwillkürlich den
Blick auf den einzigartigen baulichen Kontext
(Neue Wache mit Kastanienwäldchen und
Zeughaus) schweifen läßt. Von
außen entwickelt sich diese Treppe
aus der gekrümmten Glasfassade heraus
als Anziehungspunkt, der sich hinter der
Masse des Zeughauses hervorschiebt und damit
bereits von der Straße ‚Unter
den Linden' erkennbar ist. Im Erdgeschoß,
unter der Treppe anschliessend, weitet sich
eine kreisförmige Wartezone auf, die
es Besuchern ermöglicht, auch bei schlechtem
Wetter - vor dem Passieren des Kassenbereiches
- auf Freunde oder Bekannte zu warten. Der
direkte Zugang zu dem Wechselausstellungsgebäude
erfolgt über eine gläserne Drehtür,
zu der der Besucher mit einer mit Naturstein
verkleideten, gebogenen Wand, die sich ohne
Zäsur in den Innenraum fortsetzt, hingeführt
wird.
Auffallend sind beim ersten
Betreten des Gebäudes die wenigen,
jedoch sehr speziellen Materialien, die
verwendet wurden: Die Wände der geschlossenen
Baukörper sind vollständig mit
einem hellen französischen Kalkstein
verkleidet, der durch seinen Beigeton eine
angenehme, warme Atmosphäre vermittelt,
jedoch zugleich durch seine präzise
Bearbeitung besticht. Alle Platten dieser
Natursteinwände sind geschlossen verfugt,
wodurch die Baukörper sehr monolithisch
wirken. Alle statisch tragenden Stützen
und Geschossdecken sind mit einem besonderen
Beton ausgeführt, der sich in seiner
Farbgebung dem Stein angleicht und so zum
skulpturalen Gesamtcharakter beiträgt.
Die feine Strukturierung dieser Flächen
wurde durch eine sehr gleichmässige
Schalung aus schmalen Holzbrettern erreicht,
in die der gefärbte Beton gegossen
wurde. In dieser Schalung wurden auch sämtliche
Hohlkörper eingesetzt, in die später
Leuchten und Hinweisschilder installiert
wurden.
Die in die Glashalle ragenden,
reliefartigen Wände und Ebenen folgen
alle der Grundgeometrie des Dreiecks, das
sich aus der Grundstücksform entwickelt
hat. Dieses Raster durchzieht das ganze
Gebäude und läßt sich bis
zu den Parallelogrammen der Bodenplatten
(zusammengesetzt aus zwei Dreiecken) ablesen.
So hat das Gebäude eine grundlegende,
strenge Ordnung, die aber durch Vor- und
Rücksprünge und Auflösen
einzelner Wandscheiben immer wieder unterbrochen
ist und daher nicht zur absoluten Gestaltungsdoktrin
wird.
Als Bodenbelag ist ein amerikanischer Granit
ausgeführt, der durch große beigefarbene
Einsprenkelungen sich farblich an die den
Naturstein der Wände anlehnt.
Wie Terrassen kragen die verschiedenen
Erschliessungsebenen der Geschosse in die
Glashalle hinein und schaffen großzügigen
Foyerflächen, die für Pei konzeptionell
sehr bedeutungsvoll sind. Er will durch
diesen beeindruckenden Raum den Museumsbesuch
beim Publikum zu einem Erlebnis machen,
ein ‚urban theatre' kreieren, wie er
es einmal selbst bezeichnet hat. Dieses
Konzept ist auch bei anderen Museumsbauten
von ihm anzutreffen: so zum Beispiel bei
der Erweiterung der National Gallery of
Art in Washington und, natürlich, der
Neukonzeption des Grand Louvre in Paris,
die neben der bekannten Glaspyramide und
den Ausstellungsbereichen ein sehr weiträumiges,
unterirdisches Wegekonzept umfaßt.
Für die Ausstellungsbereiche
war die Flexibilität oberste Prämisse,
da bei den häufig wechselnden Ausstellungen
sehr unterschiedliche Objekte gezeigt werden
können. So sind die Böden als
aufnehmbare Doppelböden aus Eichenparkett
geplant, die durch Austausch einzelner Platten
an jeder Stelle einen Vitrinen- oder Computeranschluss
ermöglichen. Trotzdem können diese
Platten eine Last von bis zu 5 KN/m2 aufnehmen.
Im Untergeschoß wurde ein sogenannter
Hohlraumboden, das heisst ein geschlossener
Boden mit einem Eichen-Hirnholzbelag, ausgeführt,
der besonders belastbar ist.
Ähnlich vielfältig nutzbar sind
die mit Gipskarton verkleideten Decken:
hier ist eine Allgemeinbeleuchtung über
fest eingebaute Leuchten (Downlights) vorhanden,
zusätzlich gibt es aber, dem Dreiecksraster
der Grundgeometrie folgend, Lichtschienen,
die eine notwendige Akzentbeleuchtung aufnehmen
können. Die konditionierte Luft, die
in einem Museum eine Konstante von 21º
C und 55 % Luftfeuchtigkeit ausweisen muß,
wird über gleichmäßig verteilte
Lüftungsauslässe im ganzen Raum
verteilt, so dass auch großflächigere
Einbauten (Ausstellungskabinette) ohne Einbussen
bei der Klimatisierung möglich sind.
Die Wandflächen sind mit Gipskarton
verkleidet, der rückwärtig mit
Mehrschichtplatten aus Holz verstärkt
wurde, um auch hier ein vielfältige
Nutzung zu erlauben und der bei entsprechenden
Gebrauchsspuren auch leicht auszubessern
ist. Alle Ausstellungsgeschosse werden direkt
über einen großen Lastenaufzug
bedient, der im EG an die Anlieferungszone
im Bereich der Mollergasse anschliesst.
Das oberste Ausstellungsgeschoss
(2. OG) ist aufwendiger gestaltet: das dreiecksförmige
Grundraster der Decken ist als Kassettendecke
mit Tetraedern ausgebildet, die eine zusätzliche
Dreidimensionalität schaffen. Die sonst
geschlossenen Wände sind hier durch
grosse Fassadenelemente aufgelockert, die
eine Orientierung innerhalb der unter Umständen
sehr dichten Ausstellung ermöglichen,
da Pei immer wieder das Augenmerk auf den
städtischen Kontext richten möchte:
Ein gebogenes Fenster fokussiert das Kastanienwäldchen,
die Neue Wache, das Zeughaus und die St.
Hedwigskathedrale; eine Dachterrasse und
ein Glaserker schaffen den Sichtbezug zur
Museumsinsel.
Die beiden oberen Ausstellungsgeschosse
sind durch eine interne Wendeltreppe verbunden,
so dass diese beiden Ebenen für grössere
Ausstellungen zusammengefasst werden können.
Auch bei der Treppe begegnet der Besucher
dem Dreieck - es wirft als Oberlicht zusätzliches
Tageslicht auf den Treppenlauf.
Die beiden unteren Ausstellungsgeschosse
sind aus konservatorischen Gründen
fensterlos.
Unter diesen, der Öffentlichkeit
zugänglichen Ausstellungsgeschossen
ist über die gesamte Grundfläche
einen weiteres Kellergeschoss angeordnet,
das ausschliesslich für haustechnische
Funktionen und Depotflächen zur Verfügung
steht. Auch an diesem zusätzlichen
Flächenbedarf wird ablesbar, wieviel
Hintergrundgeschehen notwendig ist, um ein
doch verhältnismässig kleines
Museum zu betreiben.
Es war für uns ein sehr langer und
nicht immer einfacher Weg von den ersten
Zeichnungen, die in einem kleinen Team
ab Mitte 1996 entstanden, der Entwurfsvorstellung
1997, der Grundsteinlegung 1998, dem Richtfest
im April 2002, bis hin zum nun fertiggestellten
Gebäude, den wir mit unserem Kontaktarchitekten
Eller+Eller und den beteiligten Fachplanern
beschritten haben. Doch das Gelingen eines
solchen Baus ist von vielen Faktoren abhängig:
Neben einem guten Entwurf ist ein fast
ebenso wichtiger Aspekt die Unterstützung
des Bauherrn, bzw. in unserem Fall auch
die des Nutzers, die uns immer wieder
zur Seite standen. Aber auch das Engagement
der ausführenden Firmen, der genehmigenden
Behörden, und - zu guter Letzt -
die Akzeptanz der Besucher entscheiden
bei einem Gebäude letztendlich über
dessen Erfolg. Die Tage der offenen Tür
im Februar 2003 mit außerordentlichen
Besucherzahlen lassen hoffen - und es
bleibt dem Deutschen Historischen Museum
zu wünschen, das mit diesem Gebäude
eine ereignisreiche und erfolgreiche Ausstellungsgeschichte
beginnen wird.