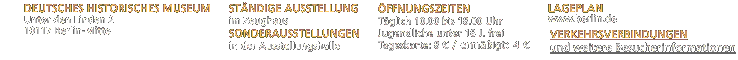|
Von
Ulrike Kretzschmar,
Abteilungsleiterin Ausstellungen und
Baureferentin des Deutschen Historischen Museums
Dieser Artikel stammt aus dem Begleitbuch
zur Ausstellung
I. M. Pei - Museumsbauten mit dem Titel:
"I. M. Pei - Der Ausstellungsbau für
das Deutsche Historische Museum, Berlin",
96 Seiten, ca. 160 größtenteils farbige,
z.T. großformatige Abbildungen , Prestel
Verlag, München, Preis 15,- €.
Als am 23. Mai 2003 das von dem Architekten Ieoh
Ming Pei entworfene, nördlich des Zeughauses
gelegene Wechselausstellungsgebäude feierlich
eröffnet wurde, ging die langjährige
und wechselvolle Planungszeit des Deutschen Historischen
Museums erfolgreich zu Ende. Politischer Widerstand
gegen das Projekt eines nationalen Geschichtsmuseums
in Berlin, der Fall der Mauer im November 1989
und eine Verlagerung des geplanten Standortes
kennzeichnen die über 16 Jahre dauernde Bauge-schichte
des Deutschen Historischen Museums: Von einer
geradlinigen Entwicklung, die direkt von der Idee
zum fertigen Gebäude geführt hätte,
kann hier keine Rede sein.
Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin
unterzeichneten am 28. Oktober 1987, anlässlich
der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin, im Reichstagsgebäude
die Gründungsvereinbarung für die Einrichtung
des Deutschen Historischen Museums. Zu diesem
Zeitpunkt war für das neue Museum noch ein
ganz anderer Bauplatz vorgesehen. Kaum ein kulturpolitisches
Vorhaben der Bundesrepublik Deutschland hat so
viele heftige und kontroverse Debatten in der
Fachwelt und in der Presse ausgelöst wie
der Plan, in West-Berlin ein historisches Museum
zu bauen. Diese Debatten bezogen sich auf Konzeption
und Standortwahl gleichermaßen. Das von
der Regierung ins Leben gerufene Geschichtsmuseum
ist eine von drei Kulturinstitutionen, die der
Bund in den 80er Jahren gründete. Es sollte
das westliche Pendant zu dem seit 1952 bestehenden
Museum für Deutsche Geschichte im damaligen
Ost-Berlin sein und zugleich das in Bonn geplante
Haus der Geschichte der Bundesrepublik ergänzen.
Noch bevor erste konzeptionelle Überlegungen
angestellt wurden oder der Name festgestanden
hätte, war die Idee eines Geschichtsmuseums
in Berlin eng mit der Diskussion über ein
geeignetes historisches Gebäude in der Stadt
verbunden. Keines der Gebäude, die damals
in Erwägung gezogen wurden - etwa der Martin-Gropius-Bau,
die Zitadelle Spandau, der Reichstag oder die
Kongresshalle -, stand jedoch wirklich zur Verfügung
oder war für das Projekt geeignet. Mit dem
Entschluss der Bundesregierung, einen Neubau zu
finanzieren, fiel im Sommer 1986 auch die Entscheidung
für den Standort: im Spreebogen, gegenüber
dem Reichstag. (1)
Für die Realisierung des neu zu gründenden
Museums war damals eine Gesamtfläche von
rund 36.000 m² Hauptnutzfläche vorgesehen.
Anlässlich des Ausgabekolloquiums im Architektenwettbewerb
am 25. August 1987 bezeichnete Bauminister Dr.
Oscar Schneider den Bau des Deutschen Historischen
Museums als "eine der verantwortungsvollsten
und reizvollsten Aufgaben, zu denen wir bis zum
Ende dieses Jahrhunderts einladen können".
(2)
Den Wettbewerb gewann im Juni 1988 der Mailänder
Architekt Aldo Rossi (1931-1997). Er entwarf für
den Spreebogen eine ganze Anthologie alteuropäischer
Architekturformen - Kolonnade, Turm, Basilika,
Fabrik, Rotunde - als eine zusammenhängende
Museumslandschaft.
Die heftige Kontroverse um das Vorhaben "Deutsches
Historisches Museum" hielt weiter an. Als
nach den Berliner Wahlen im Januar 1989 ein Regierungswechsel
stattfand, wurde das Kulturprojekt der Bundesregierung
in den Koalitionsverhandlungen unversehens zum
Politikum. Unterstützung kam jedoch von Seiten
des ehemaligen Bundeskanzlers und SPD-Vorsitzenden
Willy Brandt, der sich eindeutig für das
Deutsche Historische Museum aussprach. In seinem
Gratulationsschreiben an den neuen Regierenden
Bürgermeister hielt er es "nicht für
wünschenswert, wenn Berlin sich von diesem
Vorhaben, auf das sich auch das internationale
Interesse konzentriert, ausschlösse".
(3)
Der Mauerfall im November 1989 unterbrach die
Diskussionen bis auf weiteres und veränderten
alle bis dahin erarbeiteten Pläne von Grund
auf. Bereits Ende August 1990 beschloss die Regierung
der DDR, das im Zeughaus befindliche Museum für
Deutsche Geschichte "nicht als selbständige
Einheit fortzuführen" und gab die Institution
im September 1990 auf. Mit dem Tag der Wiedervereinigung
am 3. Oktober 1990 wurden das Zeughaus und seine
Sammlungen dem Deutschen Historischen Museum zur
temporären Nutzung übergeben. Diese
Zusammenlegung machte das Museum zur ersten gesamtdeutschen
Kultureinrichtung. Nach dem Hauptstadtbeschluss
von 1991, der den Umzug der Regierung von Bonn
nach Berlin beinhaltete, war dann 1992 klar, dass
an eine Realisierung des Rossi-Baus am geplanten
Standort nicht zu denken war. Heute steht auf
dem ins Auge gefassten Bauplatz am Spreebogen
das Bundeskanzleramt der Architekten Axel Schultes
und Charlotte Frank. Schultes hatte 1988 den dritten
Preis des Museumswettbewerbes gewonnen.
Die Räumlichkeiten, die das Zeughaus bot,
entsprachen nicht dem ursprünglichen Raum-
und Funktionsplan, der in den Jahren 1985 bis
1987 von einer Sachverständigenkommission
für das Projekt entwickelt worden war. Das
wissenschaftlich begründete Konzept des Deutschen
Historischen Museums hatte allein für die
Dauerausstellung 16.000 m² und für die
Wechselausstellung 5.000 m² gefordert. Eine
Reduktion auf das im Zeughaus-Komplex Machbare
war unumgänglich. Museum und Sachverständigenkommission
akzeptierten die notwendige Verringerung auf etwa
die Hälfte des ursprünglich geforderten
Raumprogramms.
Der neue Standort im Herzen Berlins, an der Prachtstraße
Unter den Linden, vis-à-vis der Museumsinsel,
wog jedoch alle Einschränkungen auf. Das
historische Zeughaus mit seiner Ausstellungsfläche
von ca. 7.500 m² war nun für die zukünftige
Dauerausstellung vorgesehen. Für die benötigten
Wechselausstellungsflächen sollte ein neues
Gebäude in unmittelbarer Verbindung zum Hauptgebäude
geschaffen werden. Platz hierfür bot allein
das an das Zeughaus angrenzende Grundstück,
auf dem Ende der 50er Jahre die Depot- und Werkstattgebäude
des Museums der Deutschen Geschichte errichtet
worden waren. (4)
Für die schwierige Aufgabe, ein kleines und
versteckt gelegenes Grundstück in einen attraktiven
Ort zu verwandeln, der sich zwischen zwei prominenten
Schinkelbauten - der Neuen Wache und dem Alten
Museum - sowie dem Zeughaus, dem einzigen erhaltenen
profanen Barockgebäude Berlins souverän
behaupten würde, konnte die Bundesrepublik
den Architekten I. M. Pei gewinnen.
Berühmt geworden ist der sinoamerikanische
Architekt in den siebziger und achtziger Jahren
durch seine meisterliche Verbindung von Alt und
Neu: Mit der National Gallery in Washington, mit
dem Museum of Fine Arts in Boston und vor allem
mit seinem großartigen Entwurf für
die Erweiterung und Renovierung des Grand Louvre
in Paris stellte er sein geniales Können
unter Beweis. Peis Fähigkeit, für seine
Bauten eine dem jeweiligen Ort angemessene Sprache
zu finden und eben nicht nur durch eine "typische
Handschrift" aufzufallen, machte ihn zum
idealen Architekten auch für das Deutsche
Historische Museum.
Seit er Ende 1990 aus seiner Firma Pei, Cobb,
Freed & Partners ausschied, nimmt er nur noch
wenige ausgesuchte Projekte an. Mit einem Lächeln
und Augenzwinkern verweist Pei stets auf sein
Alter, um sein wählerisches Verhalten zu
begründen. Die erste Kontaktaufnahme mit
dem Büro von I. M. Pei erfolgte Anfang Mai
1995. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne,
in Berlin ein Museum zu bauen, reagierte er interessiert,
aber auch zurückhaltend. Im Herbst kam es
dann zu einem ersten Treffen mit dem damaligen
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Das gemeinsame
intensive Gespräch über die Probleme
der neuen Hauptstadt Berlin beeindruckte I. M.
Pei nachhaltig. Wie schon vor seinem Ja zum Louvre-Projekt,
zog er in den kommenden Monaten systematisch Erkundungen
über die Bauaufgabe sowie über das architektonische
und politische Umfeld ein. Erst danach wollte
er eine definitive Antwort geben. Mehrmals besuchte
Pei in dieser Zeit Berlin - zweimal sogar "inkognito",
da er ungestört und unbeeinflusst von den
Kommentaren anderer sein wollte, um sich ein persönliches
Bild vom Standort und der damit verbundenen Aufgabenstellung
zu machen. Dabei erkannte er die "Schlüsselrolle"
des Platzgefüges Neue Wache - Kastanienwäldchen
- Zeughaus - Inselbrücke - Museumsinsel.
Dieses Ensemble, so seine tiefste Überzeugung,
könne für den flanierenden Fußgänger
zu einer unvergleichlichen Attraktion werden.
Pei war bereit, diese Herausforderung anzunehmen.
Am 26. Juni 1996 gab der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages seine Zustimmung zu einem
Neubau für die Wechselausstellungen des Deutschen
Historischen Museums und stellte die erforderlichen
Mittel bereit. Die direkte Beauftragung I. M.
Peis wurde ausdrücklich begrüßt.
Der aufwändigen Prozedur eines Wettbewerbes,
wie er bei öffentlichen Bauten zwar nicht
zwingend vorgeschrieben, aber üblich ist,
hätte sich Pei auch keinesfalls unterworfen.
Schon lange beteiligt er sich nicht mehr an Auslobungen.
Auch die Aufträge für seine spektakulärsten
Museumsbauten - in Paris, in Washington und in
Shigaraki/Kyoto, wo er das Miho Museum erbaute,
waren Direktaufträge.
Sein Hauptmotiv für die Übernahme der
Aufgabe war nicht allein die große Wertschätzung
für den Architekten Schinkel, dessen Detailgenauigkeit
für I. M. Peis eigene Werke beispielhaft
wirkt und der Umstand, dass sich zwei seiner Bauten
in unmittelbarer Nähe zum Baugrund befinden,
sondern vor allem die Tatsache, dass Pei in der
neuen Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands
arbeiten konnte. Während der Planungsarbeit
für den Neubau führten wir in seinem
New Yorker Büro viele Gespräche miteinander,
in denen er sich sehr für die Ereignisse
im November 1989, für die Wiedervereinigung
und das Zusammenwachsen von West- und Ost-Deutschland
interessierte.
Besonders aufmerksam verfolgte er die Auseinandersetzungen
über die "offenen Vermögensfragen",
in denen es vor allem um die Rückgabe von
Grundstücken bzw. die Entschädigung
von Alteigentümern ging. Pei sah hier Parallelen
zu seinem persönlichen Leben: Er selbst hatte
sich in den vorangegangenen Jahren immer wieder
erfolglos bemüht, das großväterliche
Anwesen in Suzhou/China mit seinem prächtigen
Garten für die Familie zurückzugewinnen.
Diese war von den Kommunisten im Zuge der Bodenreform
enteignet worden. Heute ist das Anwesen ein öffentlicher
Park.
Bei einem unserer zahlreichen Gespräche stellte
ich ihm die Frage, warum er eigentlich vornehmlich
im Ausland und nur noch selten in Amerika arbeite.
Er antwortete darauf, dass er die Geschichte und
Eigenheiten Amerikas kenne. Ihn interessiere bei
einem Auftrag nicht allein der Bau mit seiner
Funktion und seiner Einbindung in die Umgebung,
sondern auch die politische Geschichte des Auftraggeberlandes
und die Mentalität der dort lebenden Menschen.
Für Pei wird der Entwurf eines Gebäudes
so im wahrsten Sinne des Wortes zu einem "Gesamtkunstwerk".
Diese analytische Herangehensweise, bei der er
stets bestrebt ist, Zeit, Ort und Zweck in eine
ideale Balance zu bringen, bestimmt den persönlichen
Stil seiner Arbeiten.
Mit dem Auftrag für das Deutsche Historische
Museum in Berlin kehrt I. M. Pei zurück zu
den Wurzeln der klassischen Moderne. Auch baut
er zum ersten Mal in Deutschland, in der Stadt,
die seine Lehrer Walter Gropius und Marcel Breuer
wesentlich prägte. Für ihn schließt
sich damit gewissermaßen ein Kreis: 1934
verließ Pei als 17-Jähriger China,
um in Amerika seine Ausbildung zu beginnen. Nach
einer kurzen Zeit an der University of Pennsylvania
in Philadelphia ging er 1935 an das Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in Boston und studierte
zunächst Bauingenieurwissenschaften; bald
darauf wechselte er zur Architektur. In den ersten
Jahren seines Studiums beschäftigte er sich
intensiv mit Le Corbusier, weil er in dessen Arbeiten
den notwendigen Wandel der Architektur von der
Welt der traditionellen Schönen Künste
hin zur Moderne verwirklicht sah. Von Le Corbusier
bezog er wichtige Inspirationen für etwas
Neues. Pei erinnert sich an ihre erste persönliche
Begegnung: "Ich werde Le Corbusiers Besuch
im MIT im November 1956 nicht vergessen, schwarz
gekleidet und mit seiner dicken Brille. Die zwei
Tage mit Le Corbusier, oder 'Corbu' wie wir ihn
nannten, waren vielleicht die wichtigsten Tage
in meiner Architektenausbildung." (5)
1942 setzte Pei sein Architekturstudium
an der Harvard Graduate School of Design fort,
wo er auf Walter Gropius und Marcel Breuer traf.
Der Bauhaus-Gründer Gropius war dort im Jahr
1938 Direktor geworden und hatte eine Gruppe von
Architekten und Künstlern der Bauhaus-Schule
mitgebracht. Mit Breuer verband Pei bis zu dessen
Tod im Jahr 1981 eine sehr enge Freundschaft.
Für seine Abschlussarbeit bei Walter Gropius
erarbeite Pei 1946 seinen ersten Museumsentwurf.
Als Thema wählte er ein zweistöckiges
Kunstmuseum in Shanghai. Dies war der Auftakt
zu einer ganzen Reihe von Museumsbauten, die er
seither gestaltete. Gropius bezeichnete den ersten
Entwurf für Shanghai als die beste Studentenarbeit,
die jemals in seiner Meisterklasse erbracht wurde.
"Sie zeigt deutlich, dass ein fähiger
Designer an grundlegenden Traditionen festhalten
kann, ohne eine progressive Konzeption des Entwurfes
zu opfern." (6)
I. M. Pei, dem fernöstliche Tradition und
westliche Moderne gleichermaßen nahe stehen,
hat in seinen späteren Werken die strenge
Sachlichkeit des Bauhauses übernommen, sie
zugleich jedoch mit eleganten Formen weiterentwickelt.
Er gilt heute als Vollender der klassischen Moderne.
Die anfängliche Kritik der Fachwelt an der
Vergabe eines öffentlichen Gebäudes
ohne vorangegangenen Wettbewerb verstummte schnell,
als I. M. Pei der Öffentlichkeit am 17. Januar
1997 seinen Entwurf vorstellte. Pei hatte mit
seiner ersten Präsentation viel erreicht:
die Zustimmung der Denkmalpfleger wie auch die
der Befürworter moderner Architektur in alter
Umgebung.
"Pei´s Entwurf fügt sich in das
kleinmaßstäbliche Straßenraster
hinter dem Zeughaus ein, aber bildet dennoch mit
großer Eleganz einen völlig eigenständigen
Kristallkörper, der ohne historisierende
Ansprechungen auskommt" (7)
und "Pei, als Magier des
Raumes gepriesen, ist es in Berlin gelungen, Alt
und Neu sensibel zusammenzufügen und eine
abseitige Restfläche zum Blickfang zu adeln"
(8) , so urteilte
die Presse begeistert.
Pei verstand es, die Enge des Grundstückes
sowie die strikten Auflagen der Denkmalpflege
- deutliche Unterordnung in der Bauhöhe gegenüber
dem Zeughaus, Bewahrung der Sichtachsen von Mollergasse
und Straße Hinter dem Zeughaus -, die aus
der sensiblen Nachbarschaft zu den umliegenden
historischen Gebäuden resultierte, in einen
Vorzug umzuwandeln. Die Tatsache, dass der Neubau
nur wenige Schauseiten für Fassaden aufweisen
kann und in ihm zudem viel Nutzfläche untergebracht
werden musste, war eine weitere Herausforderung.
Pei wählte für das nur knapp 2.000 m²
große Grundstück einen in seiner Grundform
als Dreieck beschriebenen Baukörper, dessen
geometrische Strenge durch eine geschwungene,
nach Südwesten vorgelagerte Wandscheibe gelockert
wird. Zwischen Ausstellungsbau und Zeughaus vermittelt
ein beinahe gebäudehohes Glasfoyer, aus dessen
geschwungener Fassade sich ein gläserner
Treppenturm als Blickfang entwickelt.
Das Gebäude mit seinen 4.500 m² Nutzfläche
beherbergt im 1. UG, das gesamte Baugrundstück
ausnutzend, den Hauptausstellungsraum. In den
darüber liegenden drei Etagen befinden sich
weitere Präsentationsräume unterschiedlicher
Größe und Höhe, so dass auf insgesamt
2.700 m² Fläche maximal vier verschiedene
Ausstellungsthemen gezeigt werden können.
Ein kleines Auditorium mit 57 Plätzen, ein
Museumsladen, mehrere kleine Werkstatträume
sowie ein komplettes 2. UG für Zwischendepot
und Technikbereiche runden das Raumprogramm ab.
Dass das im Januar 1997 vorgestellte Modell sowie
die anlässlich des ersten Spatenstiches am
27. August 1998 präsentierte Computersimulation
zum Neubau nicht zu viel versprachen, konnten
das Fachpublikum und die Öffentlichkeit bereits
vier Jahre später beim Richtfest am 16. April
2002 mit eigenen Augen sehen.
Transparenz, Bewegung und Licht sind die Mittel,
mit denen I. M. Pei das Gebäude zum öffentlichen
Ort macht: "Sehen und gesehen werden".
Durch die vordere Glasfassade sind die inneren
Bewegungen wie durch ein Schaufenster zu erblicken.
Gleichzeitig wird dem Museumsbesucher die bisher
vernachlässigte Nordfassade des Zeughauses,
wie in einen Rahmen gefasst, durch die Glashalle
präsentiert. Der angeschlossene gläserne
Treppenturm, am Abend ein leuchtender Anziehungspunkt,
ist der einzige Bereich, der sich hinter der gewaltigen
Masse des barocken Zeughauses herauslöst
und der bereits von der Straße Unter den
Linden aus zu erkennen ist. Die Wendeltreppe des
Turmes ragt aus dem Volumen der Glashalle heraus
und inszeniert zwischen Innen- und Außenraum
eine bewusste Darbietung des historischen Umfeldes.
I. M. Pei hat mit dieser Blickachse zum Zeughaus
und zum Forum Fridericianum eine architektonische
Korrespondenz zwischen den Bauwerken der Vergangenheit
und der Gegenwart geschaffen.
Das Volumen der Glashalle fordert den Besucher
in nahezu pira-nesischem Sinne auf, das Museum
mit seinen unterschiedlichen Raumbezügen
und vertikalen Erschließungsmöglichkeiten
aus immer neuen Perspektiven zu erkunden. Vom
Verbindungsgang, der aus dem Schlüterhof
kommend bereits erdgeschossig den Durchblick zum
Neubau ermöglicht, öffnet sich im Untergeschoss
ein großer Luftraum, der den ungestörten
Blick bis in den Himmel freigibt. Diese atemberaubende
Großzügigkeit hat ihren Ursprung in
den eng gesteckten denkmalpflegerischen Vorgaben,
die Pei auf elegante Weise berücksichtigt
hat. Von den Rolltreppen, Freitreppen, Brücken
und Galerien aus fällt der Blick immer wieder
auf die gegenüberliegende Fassade des Zeughauses.
"Urban theatre" - so bezeichnete Pei
selbst seinen Museumsbau, von dessen verschiedenen
Ebenen sich beeindruckende Perspektiven in den
städtischen Raum eröffnen.
Die Ausstellungsräume liegen in einem mit
Naturstein verkleideten, weitgehend geschlossenen
Baukörper. Sie sind aus konservatorischen
Gründen überwiegend fensterlos, der
Bezug zur Grundgeometrie, dem Dreieck, bleibt
jedoch überall erhalten. Lediglich im 2.
Obergeschoss gibt es auf Wunsch von I. M. Pei
Einschnitte in den monolithischen Körper:
Ein gebogenes Fenster fokussiert die Neue Wache
mit dem umgebenden Kastanienwäldchen; eine
Dachterrasse und ein gläserner Erker schaffen
den Blickbezug zur Museumsinsel.
Dieser, auch durch die Verwendung von Naturstein
sehr skulptural wirkende und mit seinen zahlreichen
Überschneidungen, Vor- und Rücksprüngen
terrassenartig ausgebildete Baukörper wird
von der über vier Geschosse reichenden offenen
Glashalle umgriffen. Auf der Ostseite, unmittelbar
an das Verwaltungsgebäude des Deutschen Historischen
Museums angrenzend, ist ein schmaler, L-förmiger
Baukörper eingestellt, in dem sich das Auditorium
und Restaurierungswerkstätten befinden. Auch
hier begrenzen die der Grundgeometrie folgenden
Wände reliefartig die Glashalle.
Mit seinen Materialien passt sich das Gebäude
den gegenüberliegenden klassizistischen Bauten
an und setzt doch gleichzeitig ein Zeichen der
zeitgenössischen Moderne.
Die Außenfassaden der geschlossenen Baukörper
sowie die Wände in der Glashalle sind mit
einer Natursteinverkleidung aus fein geschliffenem
französischem Kalkstein ("Magny Le Louvre")
mit geschlossener Verfugung versehen. Die tragenden
Geschossdecken wurden aus so genanntem "Architekturbeton",
einem speziell eingefärbten Beton gefertigt,
dessen Struktur durch eine fein gemaserte Holzverschalung
aus "Oregon Pine" herausgearbeitet wurde.
Der an der Oberfläche geflammte nordamerikanische
Granit "Mason" mit beige- und rosafarbenen
Einsprenkelungen bedeckt die Böden des Ausstellungsbaues
sowie des Schlüterhofes und verbindet beide
Gebäude auch durch diese Materialwahl miteinander.
Glasfassade und Brüstungen wurden aus eisenoxidarmem
und daher besonders weißem Glas hergestellt.
In den Ausstellungsbereichen wurde auf eine besonders
flexible Versorgungstechnik geachtet: Die Böden
sind als Doppelböden ausgeführt, in
denen die gesamte Lüftungs- und Elektrotechnik
geführt wird. Die quadratischen Bodenplatten,
deren Oberfläche aus Eichenparkett besteht,
können gegen Platten mit Elektroauslässen
ausgewechselt werden, so dass die Stromversorgung
an jeder beliebigen Stelle des Raumes gewährleistet
ist.
Beleuchtet wird das Gebäude durch Downlights.
Die Akzentbeleuchtung in den Ausstellungsräumen
erfolgt über Lichtschienen, die dem Dreiecksraster
des Gesamtkonzeptes folgen. Lediglich im 2. OG
sind diese Dreiecke als Tetraeder ausgebildet,
um die Decke des höchsten Raumes durch eine
zusätzliche Dreidimensonalität zu akzentuieren.
Besucher können den Neubau von der Straße
Unter den Linden und von der Museumsinsel aus
durch einen eigenen, an den Treppenturm anschließenden
Haupteingang betreten. Ebenso können sie
aber den Weg durch das Zeughaus nehmen. Man überquert
den nach einem Entwurf von I. M. Pei mit Glas
überdachten Innenhof, den Schlüterhof,
und gelangt durch den ins Zeughaus eingeschnittenen,
hoch überwölbten Verbindungsgang im
Nordflügel über eine Rolltreppe in die
große, lichtdurchflutete Glashalle. Dieser
Einschnitt hat zur Folge, dass der Rundgang durch
die Dauerausstellung nicht unterbrochen werden
muss, und zudem ermöglicht er es, unter Terrain
zu kommen, da das Zeughaus nicht unterkellert
ist. Mit der Überdachung des Schlüterhofes
knüpft Pei an den Bauzustand nach 1880 an,
als nach dem Deutsch-Französischen Krieg
das Zeughaus im nördlichen Teil für
eine Ruhmeshalle umgestaltet wurde. (9)
Pei sah den Zeughaushof immer als einen Ort der
Begegnung, der mit Leben gefüllt werden sollte.
Er stellte sich hier einen mit Bäumen begrünten
Innenhof vor, in dem die Studenten der nahe gelegenen
Humboldt-Universität tagsüber ins Café
gehen und abends Musik hören können.
Seine Idee scheiterte jedoch an der Ablehnung
der Denkmalpfleger, die den Hof mit den Masken
der Sterbenden Krieger von Andreas Schlüter
in seiner Gestaltung erhalten wollten, und so
auch den Charakter des "Steinernen Berlins".
Pei hat für die Wechselbeziehung zwischen
Neubau und Zeughaus den Begriff "hand-in-glove-reciprocity"
gefunden. Die funktionale und gestalterische Raumverbindung
zwischen dem barocken Schlüterhof und dem
modernen Erweiterungsbau bietet in der Tat zahlreiche
verlockende Nutzungsmöglichkeiten.
Bei der Realisierung des Entwurfes stellte I.
M. Pei sehr hohe Ansprüche bezüglich
der Qualität von Material, Verarbeitung und
Ausführung. Diese ästhetische Kompromisslosigkeit
des Architekten war für die Projektmitarbeiter,
die Fachplaner, die Bauverwaltung und die ausführenden
Baufirmen eine große Herausforderung. Aber
gerade die Ausführungspräzision und
die strenge Materialauswahl sind das Geheimnis
von Peis Meisterwerken aus Glas und Stein.
Im Laufe des Entstehungsprozesses gab es immer
wieder Hindernisse technischer, personeller oder
politischer Art, die es zu überwinden galt;
manchmal schien die Situation so verfahren und
ausweglos zu sein, dass ein Scheitern des Projektes
zu befürchten war.
Nur der beharrliche Einsatz aller Beteiligten
führte zu dem großartigen Ergebnis,
das am 28. Februar 2003 bei der Schlüsselübergabe
bewundert werden konnte.
In einem Interview wurde Pei einmal gefragt, was
für ihn der schönste Augenblick bei
einem Projekt sei. Er antwortete: "Was ich
am meisten genieße ist das sich Erinnern
an den Prozess des Überwindens der Schwierigkeiten,
an all die Probleme, denen ich gegenüber
stand und an all die Hilfe, die ich von verschiedenen
Menschen erhalten habe, besonders von meinen Projektmitarbeitern
und Kunden". (10) Für
Pei ist daher der intensive Dialog mit seinen
Auftraggebern sehr wichtig und ausschlaggebend
auch für das Gelingen eines Bauwerkes.
Diese enge, persönliche Zusammenarbeit mündet
meist in eine sehr freundschaftliche Beziehung
zwischen Architekt und Auftraggeber. Man wird
im Laufe des Projektes gleichsam Mitglied einer
Großfamilie. Auch nach Fertigstellung der
Projekte pflegt I. M. Pei einen engen Kontakt
zu seinen "clients", der selbst nach
vielen Jahren nicht abreißt. Dies gilt auch
für unser Berliner Projekt. Im gemeinsamen
Ringen um das bestmögliche Ergebnis enstand
in den vergangenen Jahren ein sehr herzliches
Verhältnis zu I. M. Pei und seinem Büro.
Anmerkungen:
(1) Nach intensiven
Überlegungen, bei denen kurzfristig als mög-liche
Bauplätze des Museums auch das Gelände
des Völkerkunde-museums (westlich des Martin-Gropius-Baus),
das Areal des ehe-maligen Anhalter Bahnhofs, das
südlich des Bendlerblocks gelegene Grundstück
an der Stauffenbergstraße und vor allem
auch das Gebiet, auf dem einmal das Prinz-Albrecht-Palais
lag, in Betracht gezogen wurden, brachte 1986
ein städtebaulicher Wettbewerb die Lösung.
Deutsches Historisches Museum. Ideen - Kontroversen
- Perspektiven, S. 669
(2) Ebenda, S.
670
(3) Gratulationsschreiben
von Willy Brandt an den Regierenden Bürgermeister
von Berlin, Walter Momper, 17.3.1989. Archiv der
Senatskanzlei, Berlin.
(4) Schon damals
waren diese Gebäude als Erweiterungsbauten
für Ausstellungen geplant gewesen. Als aber
Ende der fünfziger Jahre die Entscheidung
fiel, dass die im Krieg erbeuteten Kunstschätze
aus der Sowjetunion wieder zurückgebracht
werden sollten, mussten die Gebäude noch
während der Bauphase in De-pot- und Werkstatthäuser
umgewandelt werden.
(5) Gero von Boehm,
Conversations with I. M. Pei, S. 36
(6) Carter Wiseman,
I. M. Pei. A profile in American Architec-ture,
S. 44 ff.
(7) Berliner Zeitung,
17.1.1997
(8) Frankfurter
Allgemeine Zeitung,20.1.1997
(9) Regina Müller,
Das Berliner Zeughaus. Die Baugeschichte, S. 165
ff.
(10) Gero von
Boehm, Conversations with I. M. Pei, S. 57
Literatur
- Deutsches Historisches Museum. Ideen - Kontroversen
- Per-spektiven. Hg. von Christoph Stölzl,
Berlin 1988
- Gero von Boehm: Conversations with I. M. Pei.
Light is the key. München 2000
- Carter Wiseman, I. M. Pei. A profile in American
Architec-ture. New York ²2001
- Regina Müller, Das Berliner Zeughaus.
Die Baugeschichte. Berlin 1994
Dieser Artikel stammt aus dem Begleitbuch zur
Ausstellung
I. M. Pei - Museumsbauten mit dem Titel:
"I. M. Pei - Der Ausstellungsbau für
das Deutsche Historische Museum, Berlin",
96 Seiten, ca. 160 größtenteils farbige,
z.T. großformatige Abbildungen , Prestel
Verlag, München, Preis 15,- €.
|