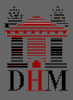 |
| Theater- plakate |
Film- plakate |
Friedens- plakate |
Sitemap | Impressum | Gästebuch DHM |
Vorwort
Die hier vorgestellten Plakate entstammen der Sammlung des Deutschen Historischen Museums (DHM) und sind auch auf einer CD-ROM (1999) erschienen, die mit einer Auswahl von rund 7.300 Plakaten einen repräsentativen Überblick über die Plakatproduktion in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bietet. Auf dieser finden sich auch zahlreiche Biographien zu den einzelnen Plakatkünstlern. Viele von ihnen entwarfen sowohl politische als auch Kulturplakate. Nur wenige waren auf ein einziges Genre spezialisiert. Eine große Anzahl illustrierte ferner Bücher, gestaltete Einbände und arbeitete freiberuflich als Graphiker. Die umfangreiche Sammlung des DHM basiert zu einem großen Teil auf dem Bestand des ehemaligen Geschichtsmuseums der DDR, des Museums für Deutsche Geschichte (MfDG).
Die für dieses Heft zusammengestellte Auswahl konzentriert sich auf drei Schwerpunkte des politischen und kulturellen Plakatschaffens der DDR: Antikriegsplakate, Theaterplakate und Filmplakate zeigen die Bandbreite der künstlerischen Ausdrucksmittel in der Gebrauchsgraphik der SBZ/ DDR. Das Spannungsverhältnis, in dem sich die Plakatkunst zwischen staatlicher Lenkung und individueller Ausdrucksform bewegte, wurde durch die Erziehungsfunktion der angewandten Kunst in einer sozialistischen Öffentlichkeit definiert. Die in diesem Heft gezeigten Themen und Sujets demonstrieren diese Zweigleisigkeit. Vom plakatierten Selbstverständnis eines "Friedensstaates" und von der Auseinandersetzung mit der identitätsstiftenden Rolle der Kultur bis zum ironischen Umgang mit vorgegebener Staatssymbolik und abstrahierenden Lösungen reicht der Darstellungsrahmen der Theaterplakate, der Filmwerbung und der politischen Appelle. Ikonographische Neuschöpfungen sind ebenso üblich wie die Aufnahme tradierter Motive. Die malerische oder zeichnerische, zum Teil recht kleinteilige und den Prinzipien einer realistischen Kunstauffassung folgende Gestaltung der fünfziger Jahre trat seit der Mitte der sechziger Jahre zugunsten einer Tendenz zum "mehrschichtigen Sinnbild" zurück; das Photo und die Typographie gewannen an Bedeutung. Die Montagetechnik, die bereits seit den zwanziger Jahren durch John Heartfield bekannt und von ihm sowie von Klaus Wittkugel in der frühen DDR weitergeführt worden war, wurde seit den sechziger Jahren von einer jungen Generation der Gebrauchsgraphiker wieder verstärkt eingesetzt. Variationsbreite der Farbkontraste, Simultanität der Bildebenen und assoziative Gestaltungsweisen belebten die Plakatgestaltung zunehmend.
Iris Hax / Katharina Klotz / Doris Müller
| oben |