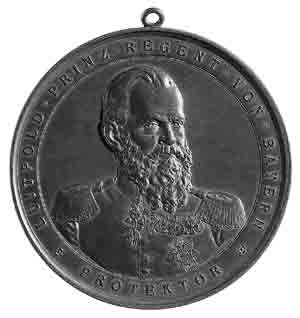II. Rückschau auf den Ursprung und die
Entwicklungstendenzen des deutschen Medaillenschaffens
von der Renaissance bis zur Gegenwart
5. Das 19. Jahrhundert
Seit der Wende zum 19. Jahrhundert wurden
kultureller und wissenschaftlich-technischer Fortschritt mehr denn je
gefeiert. Erfinder, Erfindungen und deren praxisorientierte Nutzung galt
es zu bejubeln. (Katalog-Nr. 16, 28, 35) Zur Fortschrittspropagierung
gab es zahlreiche Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbemessen und Ausstellungen
aller Art. Die Teilnehmer wollten sich, die Briefköpfe und Erzeugnisse
mit Medaillen schmücken. Dieser Wunsch ging zurück auf den Auszeichnungscharakter
vieler Medaillen, der noch aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts datierte,
als kulturelle und wissenschaftliche Leistungen mit schwergewichtigen
Goldmedaillen, dediziert "Für Kunst und Wissenschaft",
aus des Fürsten Hand belohnt wurden. Nunmehr sorgten zahllose Preismedaillen
für den gefragten Putz. (Katalog-Nr. 25, 31)
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
trat das zuvor eher stillschweigend geduldete Festhalten an früheren
Stilformen verstärkt hervor. Eine vornehmlich national geprägte
Geschichtsforschung war in den Mittelpunkt des kulturwissenschaftlichen
Interesses gerückt und erstreckte sich auf fast alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens. Historische Quellenforschung
und Nationalbewegung entdeckten das Mittelalter neu. Romanische und gotische
Kunstrichtungen kamen wieder zur Geltung. Daneben blieben Renaissance
und Klassizismus hoch im Kurs, selbst barocke Stilelemente wurden nicht
verschmäht. Mischformen bildeten sich heraus. Im Zeitalter der industriellen
Revolution galt die Perfektion bei der Medaillenherstellung mehr denn
je. Zum Medailleur trat gleichberechtigt der Techniker. Das vernichtende
Urteil der (zeitgenössischen) Kunstwissenschaft über die Medaille
des Historismus war nicht so sehr auf die Inhalte gerichtet, sondern galt
vor allem dem Umstand, daß es nicht gelang, einen neuen Stil zu
kreieren, daß formalistisch-degoutante Symbolik vorherrschte und
daß die Medaille überwiegend zur industriellen Massenware,
bestenfalls zum perfekten, aber leblosen Kunsthandwerk verkam. Die Wurzeln
dieses geschmähten "Medaillenstils", nämlich mit dem
Stilpluralismus Geschichtsbewußtsein und Patriotismus bildhaft zu
offenbaren, waren längst vergessen. Dabei ermöglichte gerade
die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts vielen Künstlern beste
Ausbildung, Förderung und Emanzipation. (Katalog-Nr. 34)
Die patriotische Nationalbewegung im
Deutschland des 19. Jahrhunderts mündete angesichts der gescheiterten
Revolution von 1848 und der nun hervorbrechenden sozialen Fragestellungen
folgerichtig in die Entwicklung einer politischen Parteienlandschaft.
(Katalog-Nr. 26, 27, 30, 33)
Immer mehr propagandistische und politische Inhalte fanden Eingang in die Medaillenthematik. Nationalbewegung, Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung bedienten sich zunehmend der Volksmedaille, einer auf große Verbreitung zielenden Kleinform aus meist wertlosem und daher preiswertem Metall. (Katalog-Nr. 29, 32)
Immer mehr propagandistische und politische Inhalte fanden Eingang in die Medaillenthematik. Nationalbewegung, Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung bedienten sich zunehmend der Volksmedaille, einer auf große Verbreitung zielenden Kleinform aus meist wertlosem und daher preiswertem Metall. (Katalog-Nr. 29, 32)