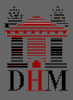 |
| Film ab! |
| Filmplakate der DEFA |
| Das szenisch-illustrative Filmplakat |
| Das "Kopf"-Plakat |
| Typographisch dominierte Plakate |
| Zeichenhaft-symbolische Plakatgestaltungen |
| Das Medium Film im Plakat |
| Ausblick |
| Theater- plakate |
Film- plakate |
Friedens- plakate |
Sitemap | Impressum | Gästebuch DHM |
Berlin - Ecke Schönhauser
Weniger eine bestimmte Szene als die Stimmung des Films vermittelt
Hans Adolf Baltzers Plakat zu "Berlin
- Ecke Schönhauser" von 1957. Der Film stellte die "verlorene" Nachkriegsgeneration
in den Mittelpunkt, zeigte Jugendliche, denen es zu Hause zu eng wurde oder
an Verständnis fehlte und die sich unter den U-Bahn-Bögen in der Schönhauser
Allee trafen. Er versuchte den sozialen Wurzeln für das Verhalten der Jugendlichen
auf die Spur zu kommen und ging dabei sehr differenziert vor. Auf dem Plakat
lenkt Baltzer den Blick von der Vordergrundfigur der jungen Frau diagonal
in den Bildraum zu einem ganzfigurig dargestellten jungen Mann. Links erinnert
eine angedeutete Mauer an das Berliner Altbau-Milieu. Die Signalfarbe Rot
erscheint im Titel und in der Kleidung. So wird einerseits der Titel mit
der Szene verbunden und andererseits das Wort "Berlin" herausgestellt. Die
Gestaltung versucht, das im Film geschilderte Lebensgefühl über die Haltung
der Dargestellten auszudrücken. Die Darstellung des Mädchens mit dem engen
roten Pullover und dem Pferdeschwanz sowie die lässige Haltung des Jungen
nehmen Motive einer nicht staatskonformen Jugendkultur auf und vermitteln
den Eindruck des "Herumhängens" und Gebarens der "Halbstarken".
Der Film gestaltete ein Zeitthema, das sowohl in Ost wie West Beachtung
fand. So drehte Georg Tressler 1956 in Westberlin "Die Halbstarken" mit
Horst Buchholz und Karin Baal, der einer ganzen Gattung von Filmen ihren
Titel gab. Der Film "Berlin - Ecke Schönhauser" von Gerhard Klein war in
der DDR heftig umstritten. Ihm wurde vorgeworfen, nur problematische und
negative Erscheinungen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Freigabe für die
Kinos erhielt der Film zwar, nachdem er in Voraufführungen bei der "Freien
Deutschen Jugend" (FDJ) positiv aufgenommen worden war, aber nach der 2.
Filmkonferenz der SED im Juli 1958 wurde die Kritik an ihm erneuert.11
Das Mädchen Rosemarie
In der DDR wurden durchaus auch Westfilme gezeigt, und sogar bundesdeutsche
Produktionen wie das "Schwarzwaldmädel" fanden ihren Weg in die Lichtspielsäle
der DDR, was sicher mehr erstaunt als die Vorführung der mit westdeutschen
Verhältnissen kritisch umgehenden Produktion "Das
Mädchen Rosemarie" von 1958. Doch die Grenze war bei den vordergründig
unpolitischen Unterhaltungsfilmen der dreißiger und vierziger Jahre mit
Zarah Leander oder Marika Rökk erreicht, die das Publikum durchaus zu sehen
wünschte. In diesen Fällen sprach sich die Abteilung Kultur des ZK der SED
gegen eine Aufführung aus, da diese Filme nicht "zur Förderung des sozialistischen
Bewußtseins" beitrügen.12
Für den Film "Das Mädchen Rosemarie" entwarf Walter Martsch ein Plakat,
das den Ausschnitt eines Szenenphotos mit der zeichenhaften Montage von
Leuchtreklameschriften verbindet. Oberhalb des Titels wird auf die beiden
Hauptdarsteller - die Publikumslieblinge Nadja Tiller und Peter van Eyck
- hingewiesen. Die Präsentation der Hauptdarstellerin in einer lasziven
Haltung und die Leuchtreklamen eines nächtlichen Vergnügungsviertels sollten
an die "dekadente" Wunderwirtschaftswelt der Bundesrepublik gemahnen. Pikanterweise
nähert sich auch die Erwähnung der bundesdeutschen Produktionsfirma und
des Regisseurs der Gestaltung der Leuchtschriften an. Der Film erzählte,
basierend auf der Geschichte der 1957 zu Tode gekommenen Frankfurter Edel-Prostituierten
Rosemarie Nitribitt, die Story des "leichten Mädchens" Rosemarie, das sich
mit den Bonzen der bundesdeutschen Wirtschaft einläßt.
| 11 | Schenk: Das zweite Leben …, 1994, S. 130 f. | |
| 12 | SAPMO, DY 30/IV 2/902/62, Herta Wolfsohn an die Abt. Kultur des ZK der SED, 26.4.1960, Bl. 120. |
| oben | weiter |
 |
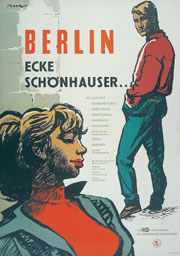 |
 |
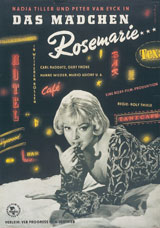 |
 |