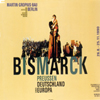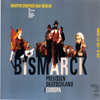| ZUR AUSSTELLUNG
Die erste große Ausstellung des Deutschen Historischen Museums
galt einer zentralen Figur der neueren deutschen Geschichte. Sie
gilt aber zugleich auch einem ganzen Zeitalter, einem Zeitalter
des Umbruchs und der Neugestaltung in praktisch allen Lebensbereichen:
dem 19. Jahrhundert und dem Übergang in die moderne Welt in
Deutschland und in weiten Teilen Europas. Die Probleme, die dieser
Übergang aufwarf, und die- meist wenig dauerhaften - Lösungen,
die man zunächst für sie fand, sind in Deutschland, aber
auch auf der europäischen Ebene in vielfältiger Weise
mit der Person und dem Wirken Otto von Bismarcks verknüpft.
Dem entspricht, daß beides, die Person und das Werk, schon
unter den Zeitgenossen heftig umkämpft und umstritten war.
Diese Kontroverse umfaßte und umfaßt stets weit mehr
als den Streit um die Einschätzung einer Person, um individuelle
Entscheidungen und Verhaltensweisen. Sie ist selber ein Spiegel
und Ausdruck des Ringens der verschiedenen geschichtlichen Kräfte,
ihrer Auseinandersetzung um den richtigen Weg in die Zukunft. So
vermag eine Ausstellung, die die Gestalt Bismarcks in den Mittelpunkt
In diesem Sinne ist die Ausstellung geplant worden, lange bevor
die Entwicklung in Osteuropa und in der DDR zu einer Situation geführt
hat, die das Verständnis für die Antriebe und Schwierigkeiten
einer deutschen Nationalstaatsbildung, mit der sich der Name Bismarcks
in erster Linie verbunden hat und verbindet, in spezieller Weise
geschärft hat. Nähe und Ferne der Gestalt und der Epoche
sollten in der unmittelbaren Anschauung, bei der Betrachtung der
Objekte und bildlichen Darstellungen, der prominenten und der alltäglichen
Zeugnisse der Zeit gleich deutlich werden, das Fremde und Unvergleichbare
ebenso aufscheinen wie das fortdauernd Vertraute und einer lebendigen
Tradition Zugehörige. Neben dem bekannten stand überall
das unbekannte 19. Jahrhundert, und dem Einmaligen, dem Spezifischen
und Unwiederholbaren galt die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Typischen
und Übergreifend-Generellen. Wie jede Ausstellung war auch
diese eine Einladung zu einer Entdeckungsreise: Klug für ein
andermal macht uns die Geschichte selten, aber gerade die Betrachtung
ihrer Vielfalt, der Verbindung des Einmaligen mit dem Übergreifenden
und Typischen, vermag den Blick zu öffnen oder doch zu schärfen
für die Freiheit des Handelns in der Geschichte. Sie ist viel
kleiner als historischer Heroenkult meint, dem diese Ausstellung
als letztes dienen will, aber viel größer als das Reden
von historischer Bestimmung, historischen Zwangsläufigkeiten
oder gar historischen Gesetzen uns nahelegen will. Die Ausstellung wurde ergänzt durch ein umfangreiches Literatur- , Musik- und Filmprogramm, das in Zusammenarbeit mit den Berliner Festspielen, dem Rias Berlin, den Freunden der Deutschen Kinemathek Berlin, den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin sowie Frieder Reininghaus und Ekhard Haack entstanden ist. Diese anderen Töne, Bilder und Worte leuchten die komplexen Facetten und Widersprüche der Epoche mit ihren Mitteln aus und machen nachvollziehbar, was dem Medium Ausstellung nicht möglich ist.
|