|
Eine historische Ausstellung hat im Gegensatz zu anderen gattungsspezifischen
Ausstellungstypen unterschiedlichstes Material zu ordnen. Sie setzt
aus verschiedensten Techniken, Maßen und Inhalten das Mosaikbild
einer Epoche zusammen. Die hier zu bewältigenden Dimensionen
reichen vom Kleinsten zum Größten, von Bismarcks Bleistift
bis zu einem Kolossalgemälde mit den Bildmaßen von 454
X 750 cm. Je heterogener die Objekte, desto ruhiger sollte die Gestaltung
wirken. Sie wird zur Technik des Hintergrundes, die sich den Dingen
einwebt. Die Vielfältigkeit der auszustellenden Materialien
führt damit zu einer Ökonomie der tatsächlichen Schritte,
zu einem Parallel-Lesen der Bilder und Objekte, die sich im Verständnis
zusammenfügen. Rhythmen und Pausen unterstreichen die Abgeschlossenheit
der Themen, betonen zugleich aber auch ihre Übergänge. Die Brüche - Wechsel der Paraventfelder, Wechsel der Farbigkeit im Raum - bestimmen die Rhythmen der Wahrnehmung. Sie wirken auf den Aufmerksamkeitspegel des Besuchers und machen ihn wach für ihre Inhalte. Vergrößerte Schriftzitatbilder von Bismarcks Hand verweisen auf die Segmente, die ihm biographisch gewidmet sind. Die Mitte der Themenräume, der zentrale Lichthof, kann bei
einer so großen Schau Synthese der "Ausstellung in der
Ausstellung" sein und Leitmotive vereinen, die in den Räumen
vertieft und wiederholt werden. Die leitmotivische Zusammenschau
dient der Einstimmung und Einleitung. Die Kolossalformate der Historienmalerei
des 19. Jahrhunderts fordern räumliche Durchlässigkeit,
verlangen Abstand und Sichtbezüge. Durch Auflösung des
lichten Raumes in Passagen und Durchgänge sind sie in Dialog
zueinander gesetzt, während die Höhe durch eine Rampe
erschlossen werden kann, die bis zur Galerie im Obergeschoß
führt. Dieser Ebenenwechsel gewährt wie eine filmische
Chronologie Ausblick, Anblick, Durchblick und Überblick als
parallele Wahrnehmung verschiedener Bildinformationen. Die Rampe
führt den Besucher der Ausstellung auf einem ritualisierten
Weg zu einer neuen Technik der Anschauung ihrer Mittel. Sie macht
den im letzten Raum entwickelten "Mythos" plastisch, den
Bismarck als nationale Kultfigur zu Lebzeiten genoß. Sie leitet
den Besucher durch die Stationen der ihm gesetzten Denkmale. Dieser
Ebenenwechsel erleichtert die Lesbarkeit der Aussage, ohne ein anderes
Ausstellungssystem zu erfordern. Zugleich aber neutralisiert er
das Pathos, indem er es optisch durchbricht. Am Haupteingang richtet der Torso eines Bismarck-Denkmals von Reinhold Begas die Blickachse auf die Ausstellung aus. Als Fokus dieses Brennspiegels lenkt die Figur den Blick von außen auf die Durchleuchtung ihrer Historizität nach innen. Die gerasterte Augenpartie an der Schwelle zum Eingang lädt in Verbindung mit dem Titel den Besucher zur Auseinandersetzung mit dem hochdramatischen Stoff im Martin-Gropius-Bau ein. Boris Podrecca |
|

Der "Weg" im Lichthof Modellstudie
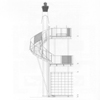
Detail des Aufgangs (Lichthof-Galerie)

Axomometrie

Elementierung der Ausstellung

Studie zum Gesamtkonzept